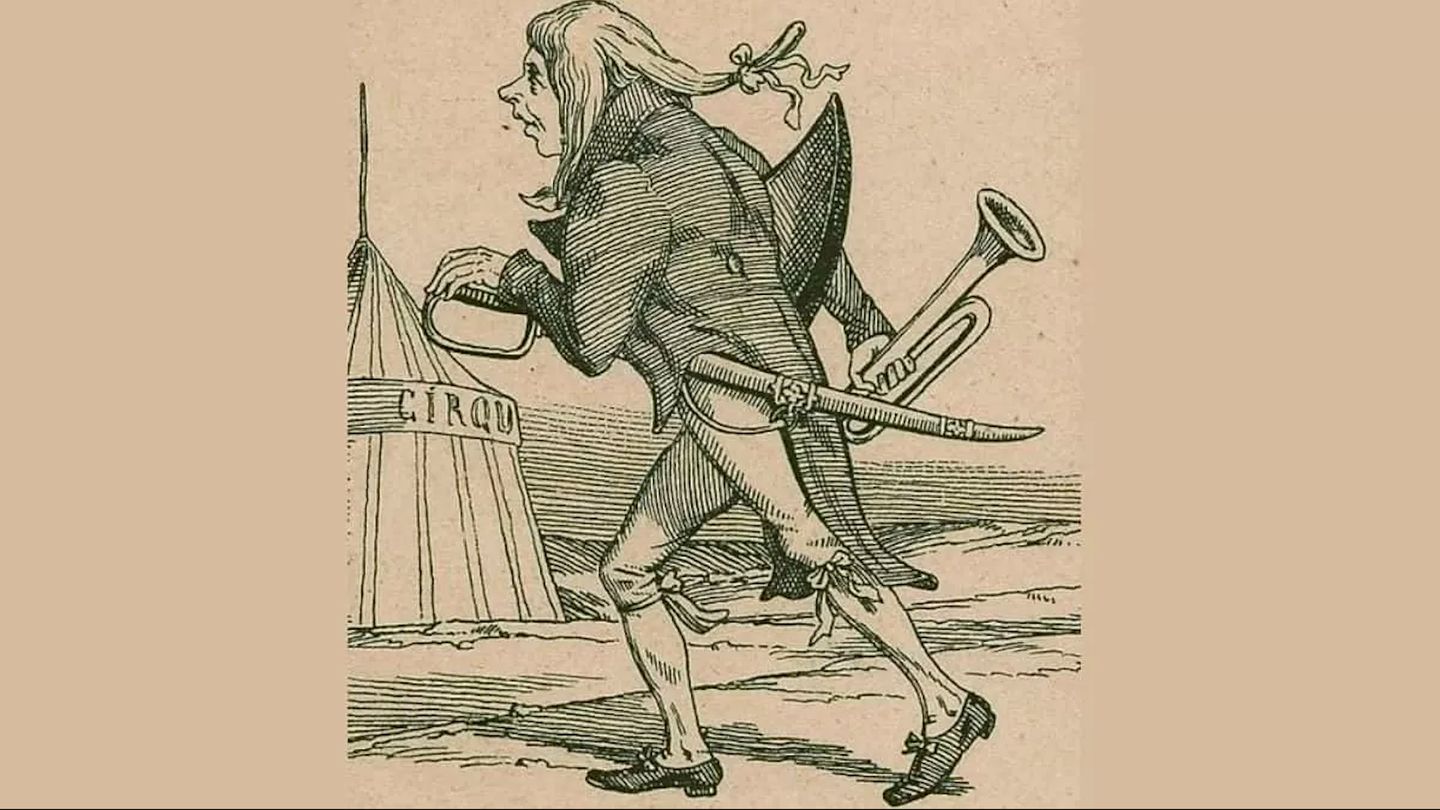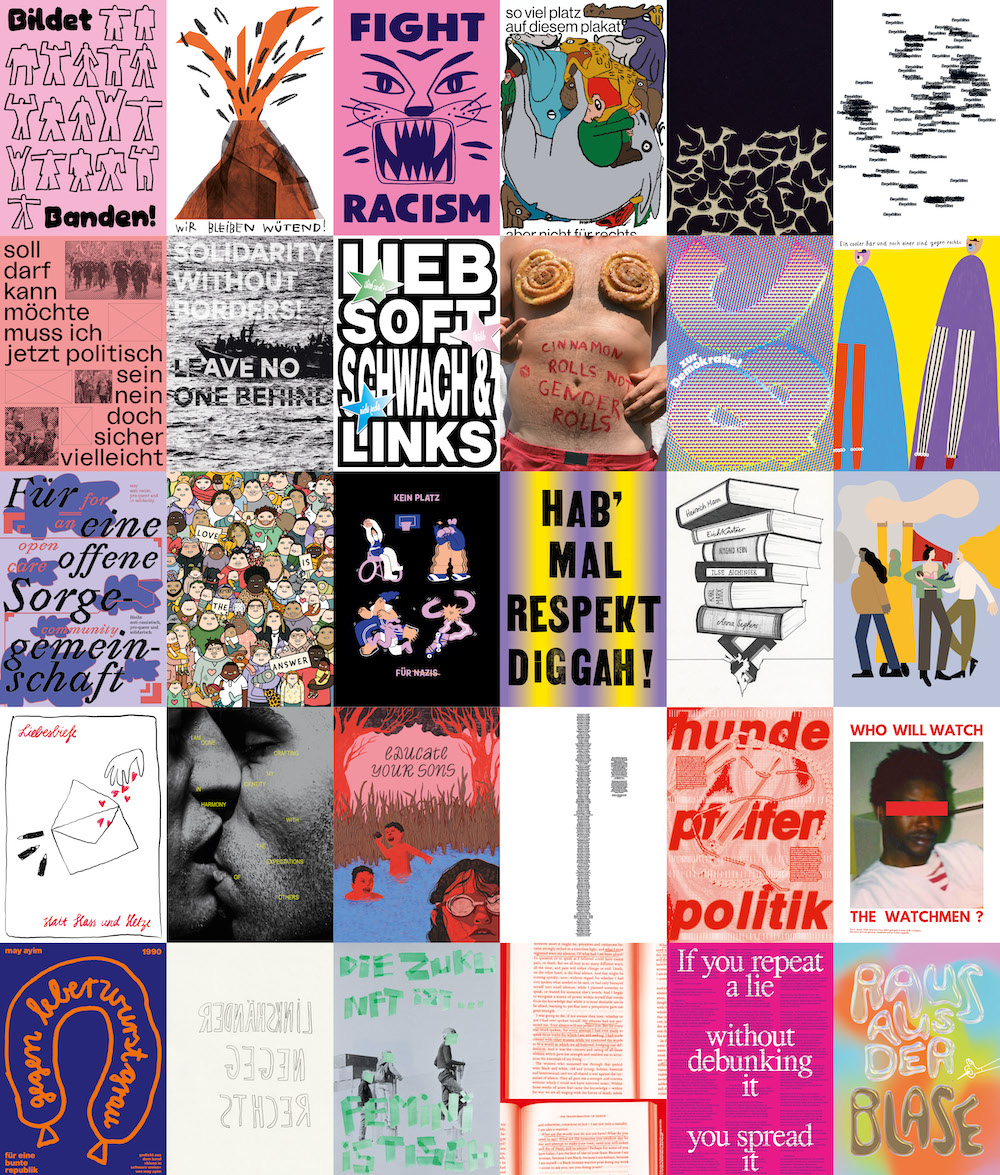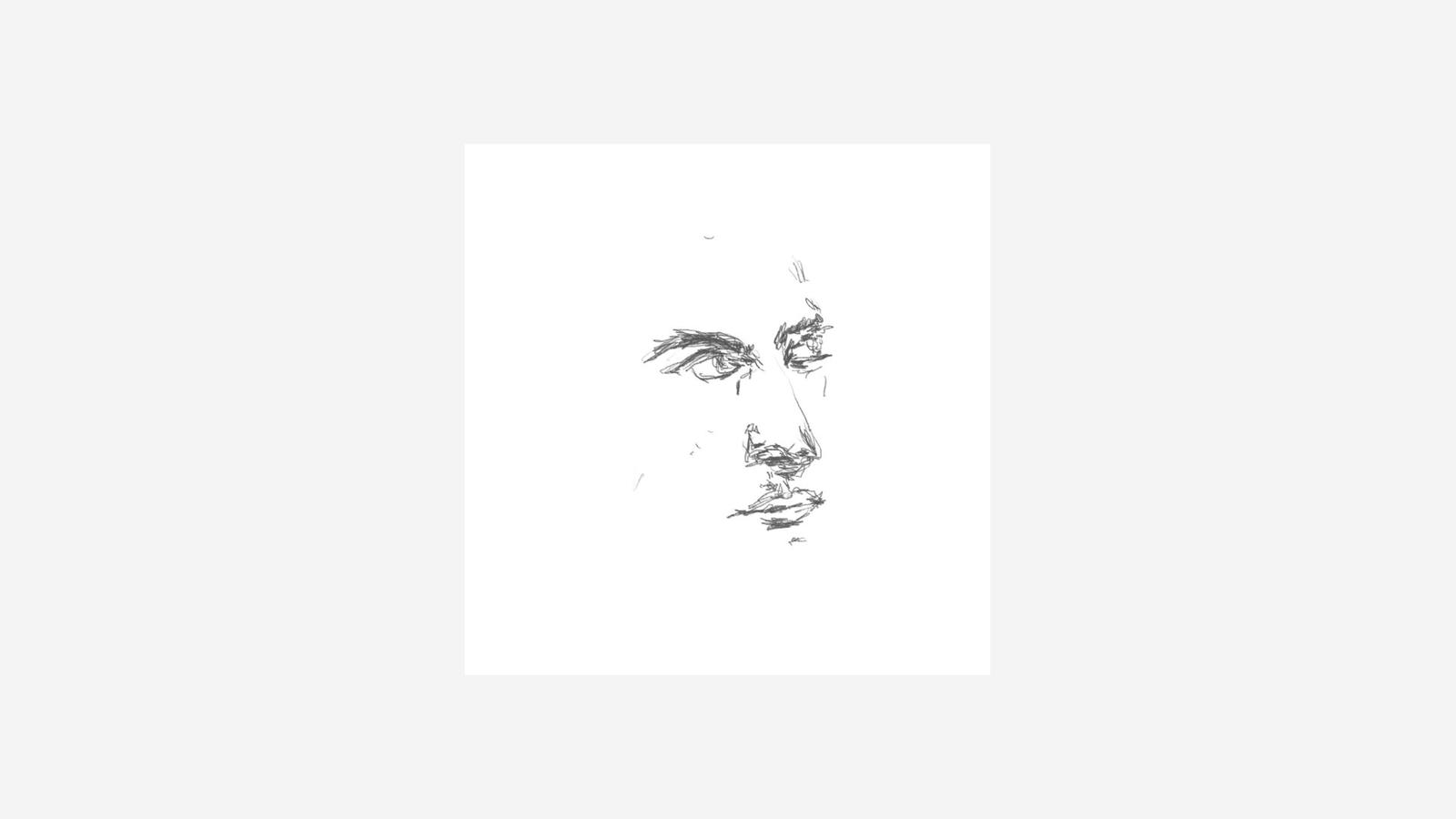Pageturner – Februar 2025: Wilde Welt(en) - Literatur von Mariana Enriquez, Varja Chandrasekera und Becky Chambers
Die Kurzgeschichten, die die argentinische Autorin Mariana Enriquez in „A Sunny Place for Shady People“ zusammenfasst, zeigen den Horror im Alltäglichen. Varja Chandrasekera reflektiert in „The Saint of Bright Doors“ eine Familienfehde in seiner Heimat Sri Lanka zwischen den Polen Gewalt und Buddhismus im intertextuellen Fantasy-Outfit. Und in Becky Chambers‘ zwei Bänden „A Psalm for the Wild-Built“ und „A Prayer for the Crown-Shy“ treffen Roboter auf Menschen und – Überraschung! – metzeln sich nicht mit dem KI-Messer nieder. Wilde Welt, wilde Wirklichkeit. Und ein kleines bisschen Hoffnung. Die Literatur-Tipps für den Februar. Mariana Enriquez – A Sunny Place for Shady People (Hogarth, 2024) Wie schön, Mariana Enriquez hat zur kurzen Form zurückgefunden. Nicht dass ihr ultraepischer Roman „Our Share of Night“ in irgendeinem Aspekt enttäuschend gewesen wäre. Aber in der spekulativen Short Story brilliert die argentinische Autorin eben wie kaum jemand sonst zur Zeit. „A Sunny Place for Shady People“ spielt nun nicht – wie das Fitzgerald-Zitat eventuell andeuten könnte – an der französischen Riviera, sondern wie gehabt zwischen Buenos Aires und Los Angeles. Es spielt zudem nicht unbedingt im (höchstens mit) Genre-Horror, sondern erkundet die Grenzbereiche, in denen das heimelige Alltägliche in etwas unbehaglich Ent- und Verfremdetes umschlägt. Wo Gewohnheiten umkippen und nichts mehr richtig sitzt und passt. Es ist aber auch eine Welt, in der die Abwesenden und Toten selbstverständlich zu den Lebenden gehören, wo Geister und Dämonen nur eine andere Art von Erinnerung und Anwesenheit darstellen. Es sind die kollektiven und die individuellen Gewalterfahrungen von meistens Frauen oder Mädchen, es ist die Trauer und die Liebe, die Familientragödien und die Straßenkultur, von Armut und Vernachlässigung durchzogen, noch immer irreparabel von der Brutalität der Diktatur gezeichnet, selbst wenn die Spuren längst verwischt sind. All die unsichtbaren Verletzungen und die allzu offensichtlichen Irritationen, von denen Enriquez schon immer zu erzählen wusste. Inzwischen kann sie das Unbehagen mit einer Selbstverständlichkeit in ihre oft auf Fragmenten realer Ereignisse, Orte oder Personen basierende Geschichten einflechten, die in der emotionalen Bandbreite immens ist. Die Stories können sich in eisklarem Body-Horror auflösen oder in milder Melancholie. Es sind immer wieder die Songs, die Enriquez beim Schreiben gehört hat, die die Tonalität setzen. Diesmal waren es unter anderem Lingua Ignota, Chelsea Wolfe und Darkthrone, und nicht weniger wichtig eben auch Lana Del Rey, Taylor Swift und Sinéad O'Connor. Varja Chandrasekera – The Saint of Bright Doors (Tor Books, 2023) Fantasy aus Sri Lanka mit mythotheologischem Überbau aus der Entwicklungsgeschichte des Buddhismus: Das ist mir bislang noch nicht untergekommen. Dass es auf dem stellaren Niveau von „The Saint of Bright Doors“ passieren würde, ist nun ebenfalls eher unerwartet. Das Schöne ist ja, dass Varja Chandrasekeras Roman vollständig im Genre aufgeht und (zumindest manche) Konvention achtet – aber doch mit sehr großer Freiheit agiert, was die Linearität und Kohärenz der Erzählung angeht, zudem mit Anspielungen und Referenzen wuchert (fancy gesagt: mit „Intertextualität“ arbeitet) und trotzdem nicht bei einem midcultig-lahmen, „literarischen“, magischen Realismus ankommt. Denn was hier passiert, ist schon ausgewachsene Weirdness für Fortgeschrittene. Irgendwo da, wo „American Gods“ schon längst zu Ende war und sich sogar ein China Miéville nur hin und wieder hintraut. Es wird erzählt von einer blutigen, generationenlangen, innerfamiliären Fehde. Der Erzähler ist eigentlich dazu ausersehen, diese Fehde für die matriarchale Seite zu entscheiden. Er wurde schon als Kind zum Töten ausgebildet, kann als Auserwählter und Verwandter eines Gottes mit Geistern und Dämonen kommunizieren (was nur wenigen Menschen möglich ist) und hat sein ganzes Leben ein Problem mit der Bodenhaftung (wörtlich, wenn er nicht permanent aufpasst schwebt er gen Himmel davon). Es geht also um einen (oder eher viele) epische wie archaische Konflikte in einer Welt, die wie aufgehobenen von Raum und Zeit wirkt. Andererseits spielt das Ganze jetzt, ist eine moderne urbane Selbstfindung, Coming-Of-Age in einer imaginären tropischen Metropole, die der realen Stadt Colombo allerdings recht ähnlich sieht. Spirituelle, soziale und queere Utopien deuten sich an, aber es bleibt eben auch die magische Realität der brutalen und seltsamen Ereignisse. So ist das Buch letztlich näher an Mariana Enriquez (speziell deren ähnlich episch-abgefahrenem „Our Share of Night“) oder Helen Oyeyemi (deren moderne Märchen-Updates eine ähnliche Dichte von wtf?-Momenten hervorbringt). In der gewaltvollen Geschichte Sri Lankas und der spirituellen des Buddhismus finden sich definitiv genügend blinde Flecken, an die hier angedockt werden konnte. Becky Chambers – A Psalm for the Wild-Built // A Prayer for the Crown-Shy (Tor Boo


Die Kurzgeschichten, die die argentinische Autorin Mariana Enriquez in „A Sunny Place for Shady People“ zusammenfasst, zeigen den Horror im Alltäglichen. Varja Chandrasekera reflektiert in „The Saint of Bright Doors“ eine Familienfehde in seiner Heimat Sri Lanka zwischen den Polen Gewalt und Buddhismus im intertextuellen Fantasy-Outfit. Und in Becky Chambers‘ zwei Bänden „A Psalm for the Wild-Built“ und „A Prayer for the Crown-Shy“ treffen Roboter auf Menschen und – Überraschung! – metzeln sich nicht mit dem KI-Messer nieder. Wilde Welt, wilde Wirklichkeit. Und ein kleines bisschen Hoffnung. Die Literatur-Tipps für den Februar.
Wie schön, Mariana Enriquez hat zur kurzen Form zurückgefunden. Nicht dass ihr ultraepischer Roman „Our Share of Night“ in irgendeinem Aspekt enttäuschend gewesen wäre. Aber in der spekulativen Short Story brilliert die argentinische Autorin eben wie kaum jemand sonst zur Zeit. „A Sunny Place for Shady People“ spielt nun nicht – wie das Fitzgerald-Zitat eventuell andeuten könnte – an der französischen Riviera, sondern wie gehabt zwischen Buenos Aires und Los Angeles. Es spielt zudem nicht unbedingt im (höchstens mit) Genre-Horror, sondern erkundet die Grenzbereiche, in denen das heimelige Alltägliche in etwas unbehaglich Ent- und Verfremdetes umschlägt. Wo Gewohnheiten umkippen und nichts mehr richtig sitzt und passt. Es ist aber auch eine Welt, in der die Abwesenden und Toten selbstverständlich zu den Lebenden gehören, wo Geister und Dämonen nur eine andere Art von Erinnerung und Anwesenheit darstellen.
Es sind die kollektiven und die individuellen Gewalterfahrungen von meistens Frauen oder Mädchen, es ist die Trauer und die Liebe, die Familientragödien und die Straßenkultur, von Armut und Vernachlässigung durchzogen, noch immer irreparabel von der Brutalität der Diktatur gezeichnet, selbst wenn die Spuren längst verwischt sind. All die unsichtbaren Verletzungen und die allzu offensichtlichen Irritationen, von denen Enriquez schon immer zu erzählen wusste. Inzwischen kann sie das Unbehagen mit einer Selbstverständlichkeit in ihre oft auf Fragmenten realer Ereignisse, Orte oder Personen basierende Geschichten einflechten, die in der emotionalen Bandbreite immens ist. Die Stories können sich in eisklarem Body-Horror auflösen oder in milder Melancholie. Es sind immer wieder die Songs, die Enriquez beim Schreiben gehört hat, die die Tonalität setzen. Diesmal waren es unter anderem Lingua Ignota, Chelsea Wolfe und Darkthrone, und nicht weniger wichtig eben auch Lana Del Rey, Taylor Swift und Sinéad O'Connor.
Fantasy aus Sri Lanka mit mythotheologischem Überbau aus der Entwicklungsgeschichte des Buddhismus: Das ist mir bislang noch nicht untergekommen. Dass es auf dem stellaren Niveau von „The Saint of Bright Doors“ passieren würde, ist nun ebenfalls eher unerwartet. Das Schöne ist ja, dass Varja Chandrasekeras Roman vollständig im Genre aufgeht und (zumindest manche) Konvention achtet – aber doch mit sehr großer Freiheit agiert, was die Linearität und Kohärenz der Erzählung angeht, zudem mit Anspielungen und Referenzen wuchert (fancy gesagt: mit „Intertextualität“ arbeitet) und trotzdem nicht bei einem midcultig-lahmen, „literarischen“, magischen Realismus ankommt. Denn was hier passiert, ist schon ausgewachsene Weirdness für Fortgeschrittene. Irgendwo da, wo „American Gods“ schon längst zu Ende war und sich sogar ein China Miéville nur hin und wieder hintraut.
Es wird erzählt von einer blutigen, generationenlangen, innerfamiliären Fehde. Der Erzähler ist eigentlich dazu ausersehen, diese Fehde für die matriarchale Seite zu entscheiden. Er wurde schon als Kind zum Töten ausgebildet, kann als Auserwählter und Verwandter eines Gottes mit Geistern und Dämonen kommunizieren (was nur wenigen Menschen möglich ist) und hat sein ganzes Leben ein Problem mit der Bodenhaftung (wörtlich, wenn er nicht permanent aufpasst schwebt er gen Himmel davon). Es geht also um einen (oder eher viele) epische wie archaische Konflikte in einer Welt, die wie aufgehobenen von Raum und Zeit wirkt. Andererseits spielt das Ganze jetzt, ist eine moderne urbane Selbstfindung, Coming-Of-Age in einer imaginären tropischen Metropole, die der realen Stadt Colombo allerdings recht ähnlich sieht. Spirituelle, soziale und queere Utopien deuten sich an, aber es bleibt eben auch die magische Realität der brutalen und seltsamen Ereignisse. So ist das Buch letztlich näher an Mariana Enriquez (speziell deren ähnlich episch-abgefahrenem „Our Share of Night“) oder Helen Oyeyemi (deren moderne Märchen-Updates eine ähnliche Dichte von wtf?-Momenten hervorbringt). In der gewaltvollen Geschichte Sri Lankas und der spirituellen des Buddhismus finden sich definitiv genügend blinde Flecken, an die hier angedockt werden konnte.
Es war einmal die Singularität. Und sie war einmal völlig anders als erwartet. Die Maschinen, sie erwachten viel früher als bei Industrierobotern der Komplexität eines besseren Taschenrechners gedacht. So unerklärlich diese Bewusstseinswerdung, noch überraschender war, dass sie einfach so passierte – ohne jegliche Ambition die Menschheit auszulöschen oder zu knechten. Stattdessen zogen sie sich freiwillig zurück in die unzugänglichsten Ecken der Welt, um dort unbehelligt ihr Ding zu machen, vorwiegend Tierbeobachtung und Naturbetrachtung. Was auch schon mal Jahrzehnte dauern darf, wenn etwa einem Baum beim Wachsen zugesehen wird. Gegangen mit dem Versprechen, den Menschen zu helfen ihre Bedürfnisse zu erfüllen, sollten sie einander jemals wieder begegnen. Was über viele Jahrhunderte tatsächlich nicht mehr passiert und sowohl das „Parting Promise“ wie auch die Existenz der Roboter bei den Menschen zum Mythos macht und umgekehrt die der Menschen bei den Robotern.
Die Menschheit hat indes – nicht zuletzt vom Schock des Erwachens der Maschinen – die Selbstauslöschung durch Umweltzerstörung, Ressourcenverbrauch und Kriege knapp verfehlt und befindet sich in einer Ära der nachhaltigen Selbstversorgung und des sensiblen wie vernunftgesteuerten Umgangs mit Natur, Technologie und Mitmenschen. Sogar die Religion wurde zu einer undogmatischen zugewandten Sache, praktiziert etwa von Tee-Mönchen, die sich die Sorgen der Menschen anhören und mit einer je nach Problemstellung tröstenden oder aufmunternden Teemischung (und individuell platzierten Ratschlägen) wieder entlassen. Es ist eine Art sanfter Kommunismus des richtigen Maßes, was hier praktiziert wird, einer der weder aus Überfluss und Exzess noch aus Mangel und revolutionärem Umsturz entstand und so harmonisch und organisch wirkt, als die quasi-natürliche beste Lebensform, in der jeder bekommt was er braucht und gar nicht mehr will, einfach so. Das ist also eine durchaus extreme Wohlfühlutopie, in der ein wandernder, also mit dem Lastenrad reisender Tea-Monk (they/them) aus Hyggeland auf einen der mythischen in der (hin und wieder durchaus lebensgefährlichen, aber meistens nur von Pflanzenstacheln und beißenden saugenden Insekten unwirtlichen) Wildnis lebenden Roboter trifft, ebenfalls auf einer Art Pilgerreisen zu den mythischen Menschen. Was dann passiert, ist eben gerade kein „Krieg der Welten“ oder „Clash of Civilizations“, sondern – nachdem die ersten gegenseitigen Ängste überwunden sind – zivilisierte Kommunikation, ein Austausch philosophisch-ethischer Weltverständnisse, eine echte Begegnung.
Im ersten Band dieser (leider nur) Duologie geht es um die Begegnung, ein gegenseitiges Grundverständnis zu finden auf individueller Ebene: Und darum wie das alte Versprechen – den Menschen zu helfen und ihnen zu geben was sie brauchen – denn nun eingelöst werden kann. Doch was brauchen die Menschen wirklich? Zum Überleben? Zum Leben? Zum Glück? Zur Zufriedenheit? Zum „guten“ Leben? Der zweite Band führt diese Sinn- und Zwecksuche weiter in die Tiefe und gesellschaftliche Verwicklungen. Und erinnert an die gar nicht so guten alten Zeiten. Es ist unglaublich, wie viel Hoffnung und Vertrauen in die Fähigkeit der Menschen von ihren Fehlern zu lernen und aufeinander zuzugehen, diese beiden viel zu kurzen Büchlein vermitteln. Das basale Wissen um die Möglichkeit des Guten, was für eine krasse Zukunftsvision.
Mariana Enriquez – A Sunny Place for Shady People (Hogarth, 2024)
Varja Chandrasekera – The Saint of Bright Doors (Tor Books, 2023)
Becky Chambers – A Psalm for the Wild-Built // A Prayer for the Crown-Shy (Tor Books, 2021 & 2022)