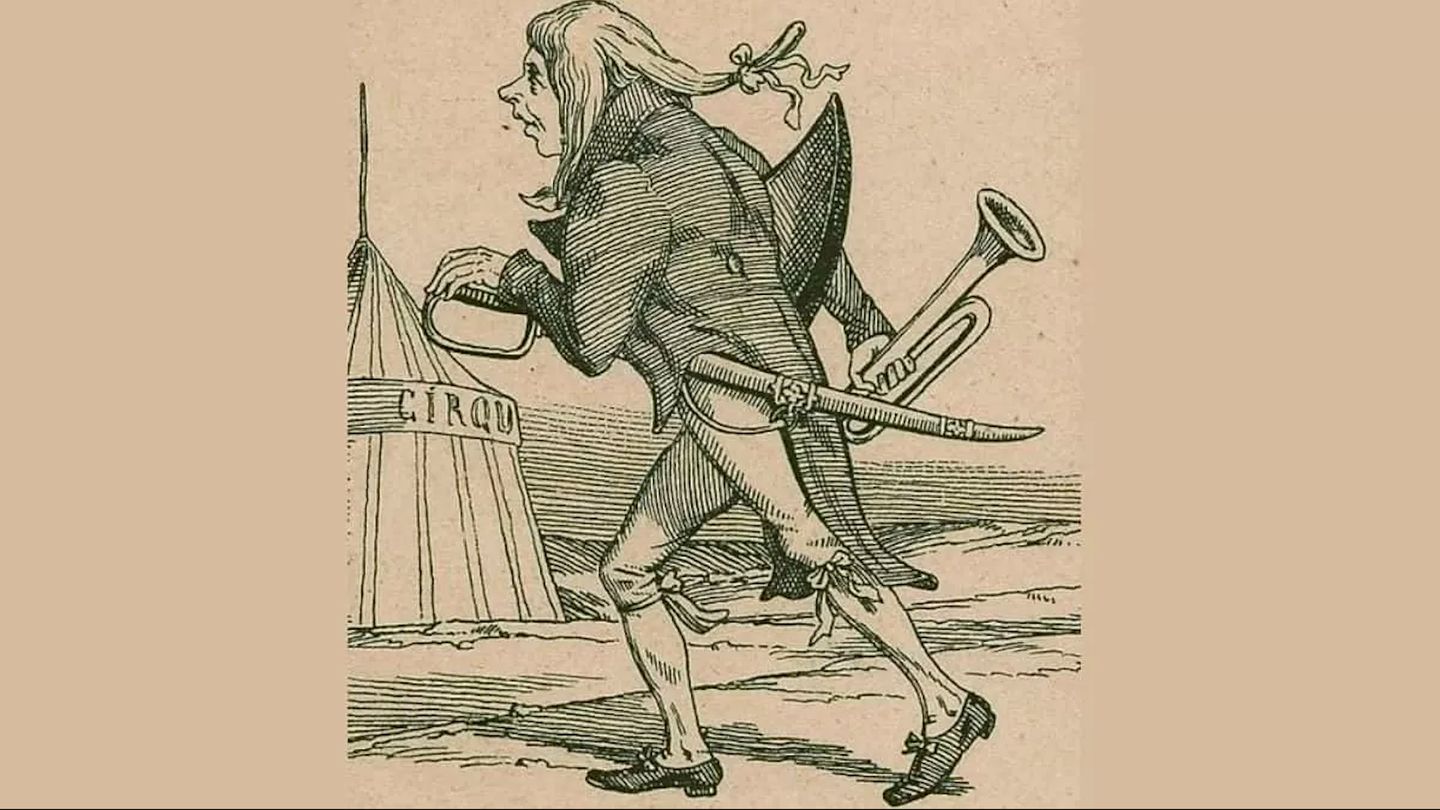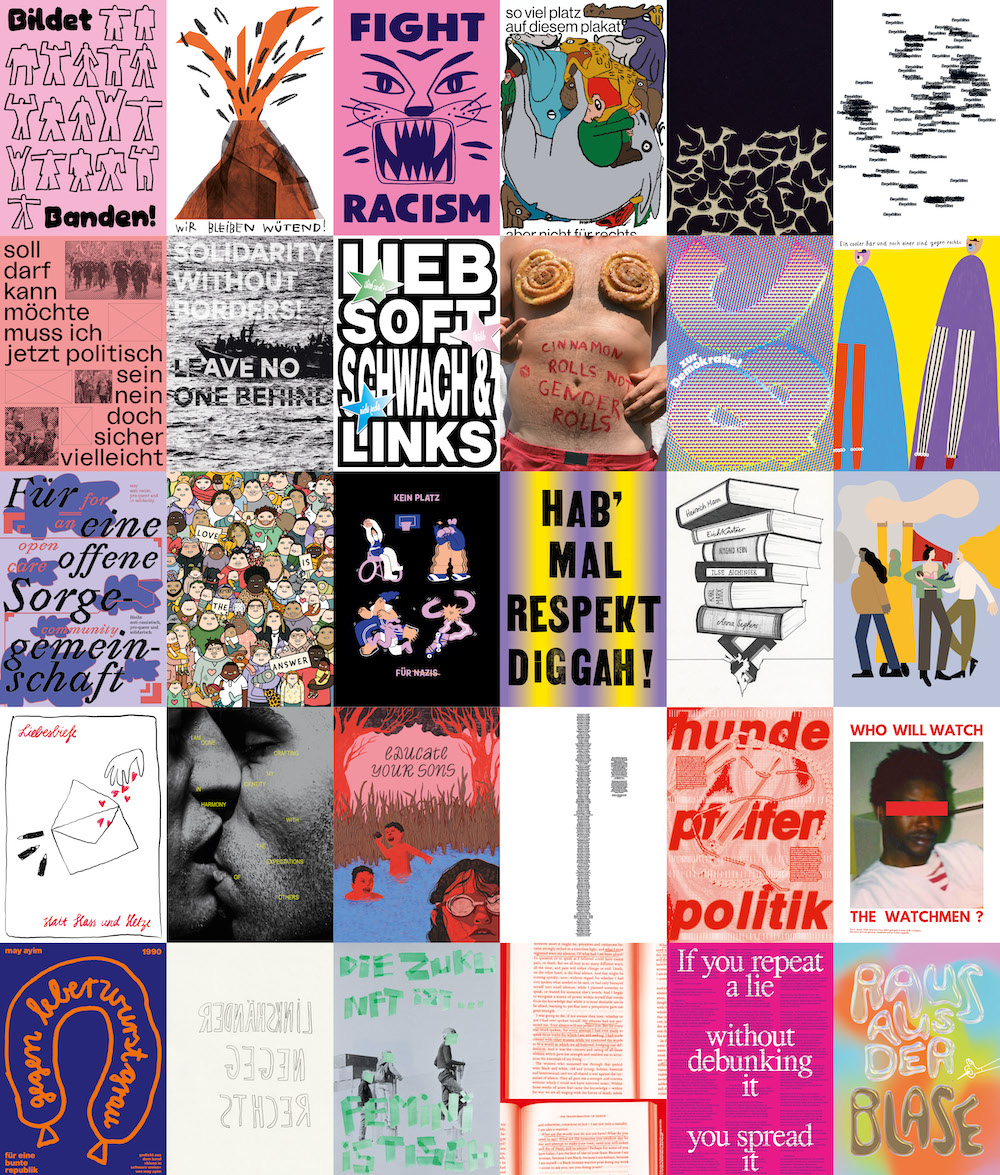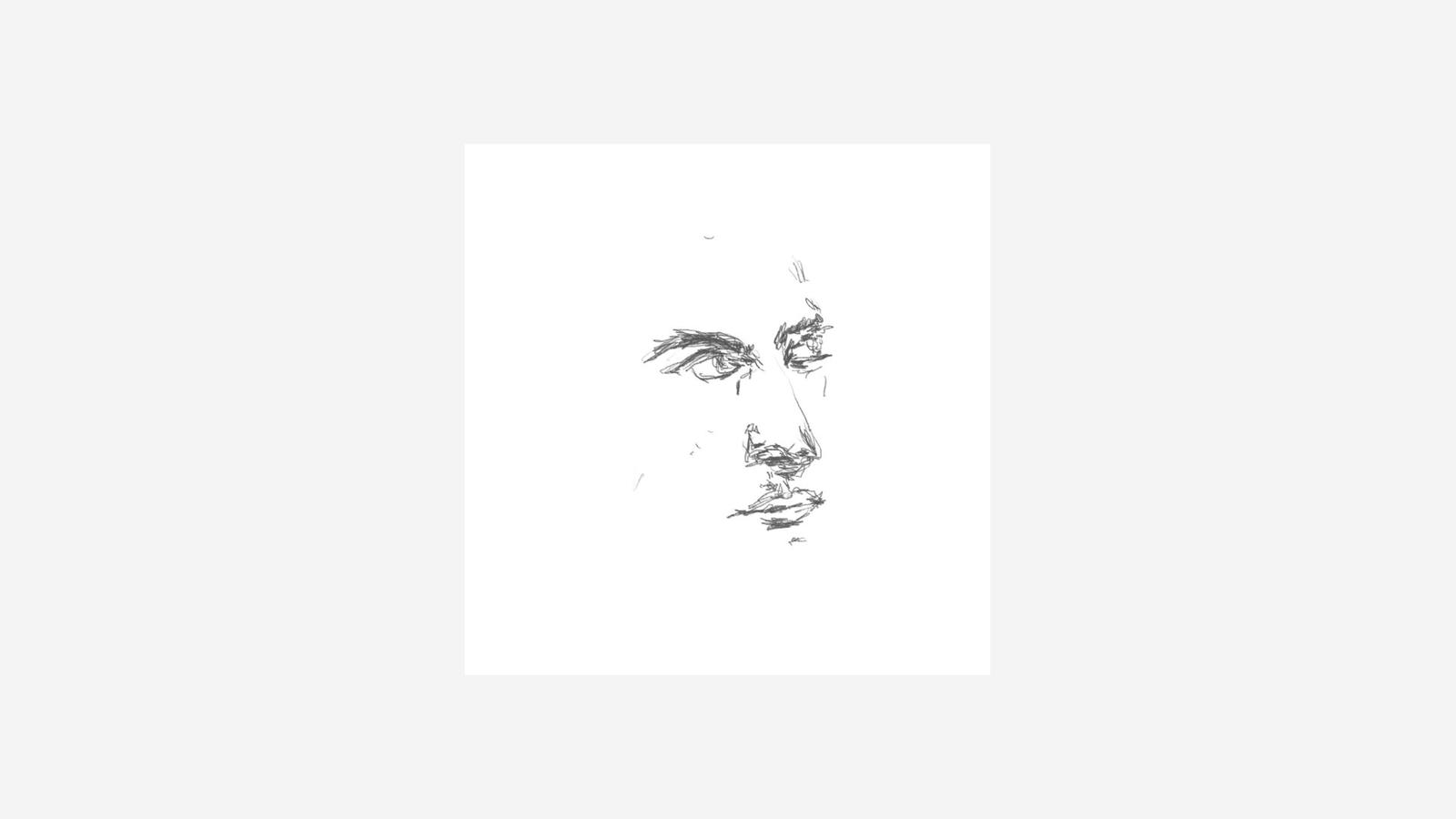Altersverifikation: Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt
Erwägungsgrund 38 der DSGVO besagt, dass Kinder besonderen Schutz bei ihren personenbezogenen Daten benötigen, da sie sich der Risiken, Folgen und Rechte oft weniger bewusst sind. Dies macht die Altersverifikation zu einem zentralen Thema. Der Schutz der Privatsphäre von Kindern erfasst neben dem Datenschutz auch den Jugendschutz und die sichere Nutzung von Online-Diensten. In diesem […]

Erwägungsgrund 38 der DSGVO besagt, dass Kinder besonderen Schutz bei ihren personenbezogenen Daten benötigen, da sie sich der Risiken, Folgen und Rechte oft weniger bewusst sind. Dies macht die Altersverifikation zu einem zentralen Thema. Der Schutz der Privatsphäre von Kindern erfasst neben dem Datenschutz auch den Jugendschutz und die sichere Nutzung von Online-Diensten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Ansätze und Herausforderungen der Altersverifikation sowie die damit verbundenen rechtlichen und technischen Fragestellungen.
Ansätze und Herausforderungen
Mit der zunehmenden Digitalisierung wird es für Kinder immer leichter, auf Plattformen und Dienste zuzugreifen, die ggf. ursprünglich nicht für sie gedacht waren. Dies stellt Unternehmen vor die Aufgabe, wirksame und zugleich datenschutzkonforme Altersüberprüfungssysteme zu entwickeln. Dabei müssen sie einen Spagat zwischen der Sicherheit der Kinder und der Vermeidung übermäßiger Datenerhebung meistern. Welche – nicht nur sanktionsrechtlichen – Auswirkungen ein unzureichender Schutz haben kann, zeigt der Tod einer 10-jährigen TikTok-Userin, über dessen tragischen Fall wir bereits berichteten.
Welche Ansätze in der Praxis existieren und welche Herausforderungen sie mit sich bringen, wurde auch auf dem Chaos Communication Congress 2024 diskutiert.
Methoden der Altersverifikation
Es gibt mehrere Methoden zur Altersverifikation, die je nach Ansatz eine unterschiedliche Zugänglichkeit und Vertrauensniveau aufweisen.
Selbstständige Altersangabe
Die denkbar einfachste Methode stellt die selbstständige Alterseingabe der Nutzer:innen dar. Dass dies mit einem sehr geringen Vertrauensniveau einhergeht, ist selbstredend.
Abgleich biometrischer Daten
Eine weitere Möglichkeit ist die Altersschätzung durch biometrische Daten oder gar einer Verhaltensanalysen. Diese Methode verwendet Technologien wie die Gesichtserkennung, die Analyse der Stimme oder Nutzungsverhalten.
- Bei der Gesichtserkennung werden bspw. Gesichtsproportionen oder die Hautstruktur genutzt, um das Alter der Person zu schätzen.
- Die Stimmanalyse setzt auf biometrische Merkmale wie der Tonhöhe oder die Komplexität von Sprachmustern.
- Durch eine Analyse des Nutzerverhaltens wird z. B. untersucht, wie sich User:innen auf einer App oder Website verhalten (haben), um Rückschlüsse auf das jeweilige Alter zu ziehen. Bspw. könnten hierfür Suchanfragen in Browsern oder das Klickverhalten auf altersgerechte Werbeanzeigen herangezogen werden.
Durch die Analyse solcher sensiblen Daten wird ein moderat hohes Vertrauensniveau erreicht, jedoch ist sie aufgrund des möglichen invasiven Eingriffs und der Verarbeitung umfangreicher Datenmengen datenschutzrechtlich als kritisch einzustufen, da besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 DSGVO auch einen höheren Schutz genießen. Zudem wird auch Art. 22 DSGVO zu berücksichtigen sein, wenn es hier zu einer automatischen Entscheidungsfindung kommt.
Eindeutige Identifikatoren und Verifizierungsquellen
Eine weitere Methode stellt die Einbeziehung von sog. eindeutigen Identifikatoren und verifizierten Identifikationsquellen dar. Eindeutige Identifikatoren sind Daten, die eine Person eindeutig identifizieren können, weil sie direkt mit der Person verknüpft sind bzw. werden. Dies sind etwa die Personalausweisnummer oder der Fingerabdruck. Bei den verifizierten Identifikationsquellen handelt es sich um externe Stellen, die die Identität einer bestimmten Person bereits überprüft haben und somit auch gegenüber anderen Stellen bestätigen können. Dies sind bspw. Banken, bei denen User:innen bereits positiv z. B. ein Video- oder Post-Ident-Verfahren durchlaufen haben.
Diese Methode hat ein hohes Vertrauensniveau, birgt aber auch einige Herausforderungen, etwa bezüglich der Systemanbindung und Datenschutzbestimmungen.
Rechtliche Aspekte der Altersverifikation
Wie bereits hinsichtlich der Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO angedeutet, sind insb. in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Altersverifikation die datenschutzrechtlichen Grundsätze einzuhalten.
Daneben existieren spezifische Regelungen, etwa im Jugendschutz (z. B. die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMSD-RL), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) oder Glückspielsstaatsvertrag (GlüStV)), die die Altersverifikation in bestimmten Bereichen wie Glücksspiel oder jugendgefährdenden Inhalten regeln. Die AVMSD-RL verfolgt dabei den Zweck, einen einheitlichen Markt für audiovisuelle Mediendienste zu schaffen, kulturelle Vielfalt zu fördern und Verbraucher sowie Kinder angemessen zu schützen.
Das gemeinsame Ziel und die Herausforderung dieser Richtlinien und Gesetze bestehen darin, sowohl Schutz vor schädlichen Inhalten wie Gewalt oder Grooming zu gewährleisten als auch den Zugang zu digitalen Inhalten und die damit verbundene digitale Teilhabe sicherzustellen. Da Systeme zur Altersverifikation naturgemäß den Zugang einschränken können, ist hierbei ein ausgewogener Ansatz erforderlich.
Abwägung berechtigter Interessen
Hinsichtlich einer Interessenabwägung i. S. v. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.
- Interessen des Kindes: Die schutzwürdigen Interessen sind bspw. der Schutz vor schädlichen Inhalten, Datenschutz und digitaler Teilhabe. Dabei ist das Wohl des Kindes entsprechend Art. 3 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes als vorrangig zu berücksichtigen.
- Die Interessen der Plattform- bzw. Diensteanbieter bestehen z. B. neben wirtschaftlichen Interessen – Kosten für die Implementierung eines geeigneten Systems – auch im Erhalt der Benutzerfreundlichkeit, da zu komplizierte Verfahren Nutzer:innen abschrecken könnte.
- Diese schließen die Interessen der übrigen User:innen mit ein. Zu beachten sind bspw. Chilling Effects und die Gefahr von exklusiven Systemen, bei denen Nutzer:innen durch Verifikation ausgeschlossen werden könnten. Chilling Effect bedeutet, dass User:innen möglicherweise aus Angst vor komplizierten oder invasiven Verifikationsprozessen auf die Nutzung bestimmter Dienste oder Webseiten verzichten, selbst wenn sie rechtmäßig Zugang dazu hätten. In diesem Zusammenhang wurde im Chaos Communication Congress 2024 davor gewarnt, dass durch die Altersverifikation Anonymität und Pseudonymität im Internet verloren gehen könnten, was wiederum zu Chilling Effects führen könnte und somit zu einer Einschränkung der digitalen Teilhabe
Die Altersverifikation stellt nicht die Lösung für alle Probleme des Kinderschutzes im Internet dar. Auch andere, weniger invasive Methoden wie die Content Moderation und Aufklärung sollten mit in eine Interessenabwägung einfließen. Auch muss die Implementierung von Altersverifikationsmethoden nicht als absolute Eintrittsbarriere verstanden werden, sondern könnte genauso gut auch nur die Teile eines Dienstes bzw. Inhalte betreffen, die einer Altersbeschränkung unterliegen.
Umsetzung der Altersverifikation weiterhin problematisch
Die Altersverifikation im Internet ist ein komplexes Thema, das datenschutzrechtliche und technische Herausforderungen umfasst. Während sie als notwendiges Mittel zum Kinderschutz verstanden werden kann, muss sie unter Beachtung der Grundrechte und des Datenschutzes durchgeführt werden. Die Praktikabilität und Umsetzung von Altersverifikationsmethoden müssen daher sorgfältig geplant werden, um Missbrauch und Ausschluss zu vermeiden.
Gefällt Ihnen der Beitrag?
Dann unterstützen Sie uns doch mit einer Empfehlung per:
TWITTER FACEBOOK E-MAIL XING
Oder schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Beitrag:
HIER KOMMENTIEREN
© www.intersoft-consulting.de