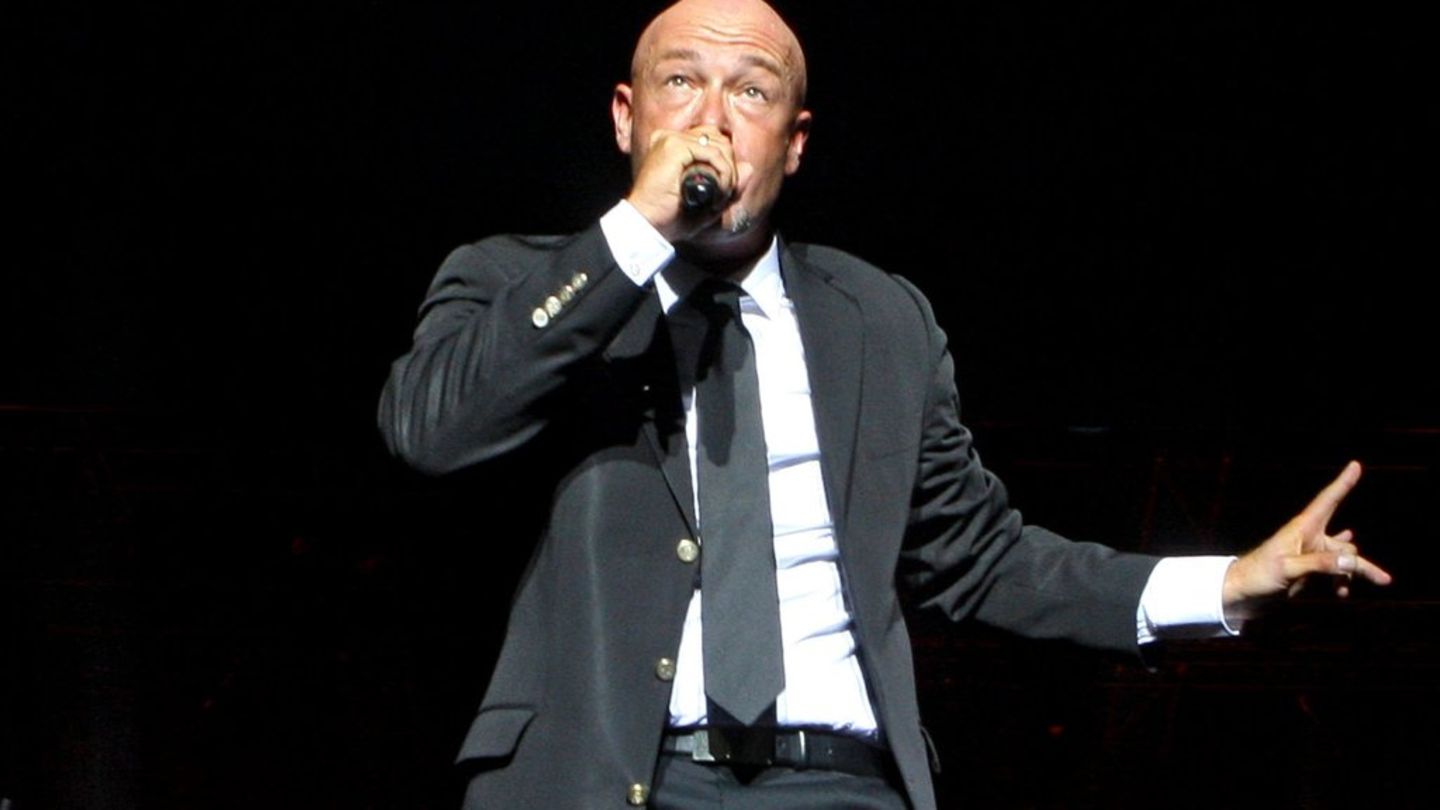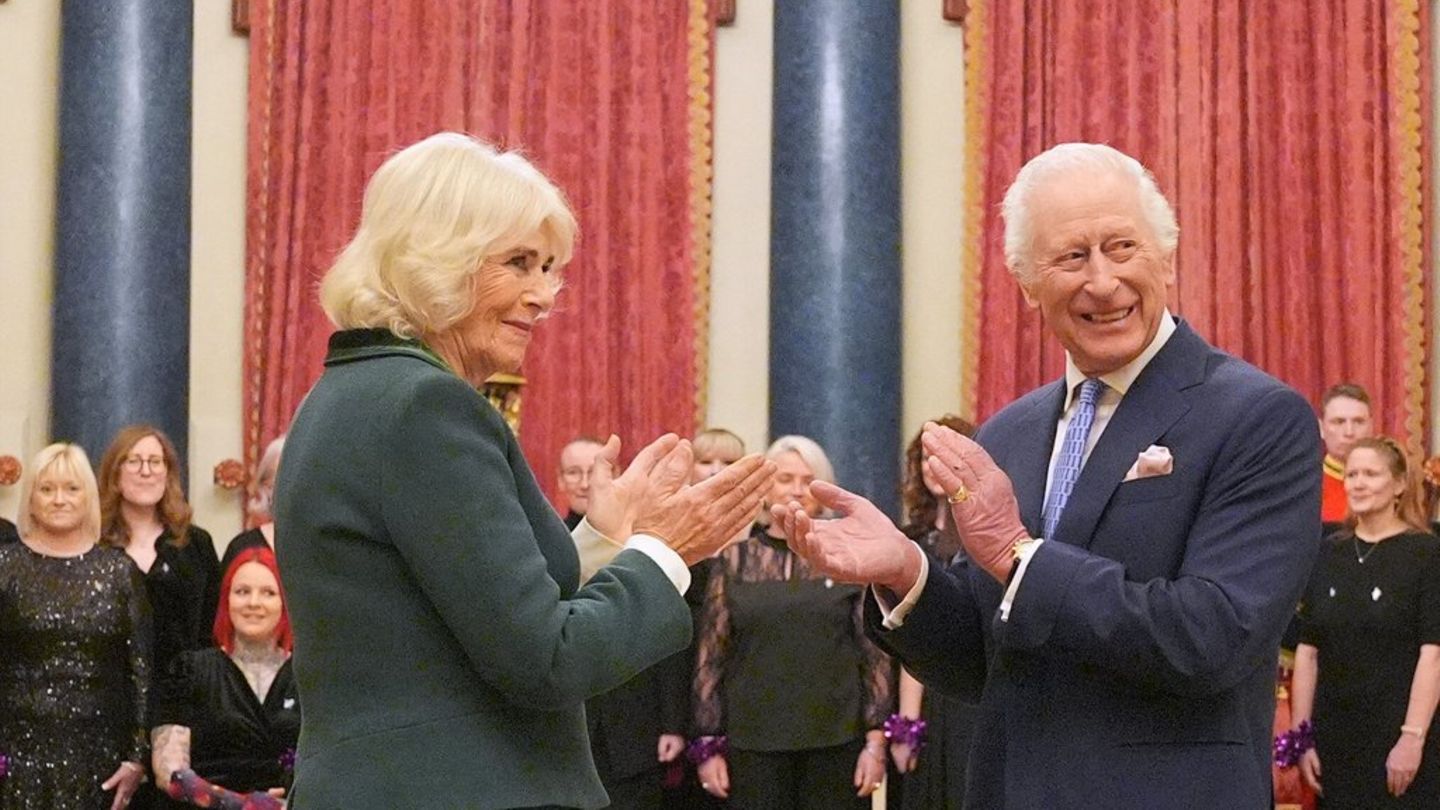Vor allem Frauen betroffen: Was es mit der Frozen Shoulder auf sich hat
Eine schmerzhafte Schultersteife betrifft typischerweise Frauen zwischen 40 und 60. Das ist kein Zufall und doch wird der Zusammenhang mit der Hormonumstellung durch die Menopause noch häufig verkannt oder übersehen.

Eine schmerzhafte Schultersteife betrifft typischerweise Frauen zwischen 40 und 60. Das ist kein Zufall und doch wird der Zusammenhang mit der Hormonumstellung durch die Menopause noch häufig verkannt oder übersehen.
Die Haare bürsten, ein Glas aus dem Küchenschrank nehmen, den Mantel an einen Garderobenhaken hängen? Nicht dran zu denken! Eine Frozen Shoulder oder Schultersteife schmerzt nicht nur, sie macht alltägliche Handlungen, für die wir den Arm heben müssen, regelrecht unmöglich und beeinträchtigt die Lebensqualität daher enorm. In alle Richtungen geht die Bewegungsfähigkeit der Schulter verloren, so als würde das Gelenk einfrieren.
Die gute Nachricht: Das gibt sich wieder. Die schlechte: Es dauert ein paar Jahre.
Ein Verlauf in drei Phasen
Die Schulter ist unser beweglichstes und gleichzeitig unser kompliziertestes Gelenk. Wie sehr wir es täglich beanspruchen, merken wir erst, wenn es dabei wehtut.
Es kommen dafür eine ganze Reihe von Ursachen infrage, etwa Arthrose, also der klassische Verschleiß, aber auch eine Schleimbeutelentzündung, das sogenannte Impingement-Syndrom, bei dem Gewebe, also Muskeln, Sehnen oder Nerven, unter dem Schulterdach eingeklemmt werden, oder eben eine Frozen Shoulder, Adhäsive Kapsulitis in der Fachsprache.
Dabei schrumpft und verhärtet die Gelenkkapsel der Schulter. Typischerweise ist die Seite der nicht-dominanten Hand betroffen. Das Gewebe, das Oberarm- und Schulterblattknochen verbindet, vernarbt – und das meist ohne vorherige Verletzung oder Infektion.
Die Erkrankung verläuft typischerweise in drei Stadien:
- Freezing: Einfrieren (ein bis drei Monate) – eine Seite der Schulter beginnt immer stärker zu schmerzen – auch in Ruhe oder nachts, wenn man auf der Seite liegt. Den Arm nach oben zu nehmen oder hinter den Rücken, fällt zunehmend schwer und wird wegen der Schmerzen lieber vermieden. Die Gelenkkapsel ist akut entzündet.
- Frozen: Eingefroren (vier bis 12 Monate) – die Schulter versteift und lässt praktisch keine Beweglichkeit mehr zu. Das Gewebe der Gelenkkapsel ist nicht mehr entzündet, aber hart, vernarbt und geschrumpft. Durch die Ruhigstellung baut sich Schultermuskulatur ab.
- Thawing: Auftauen (zwei Jahre und länger) – langsam löst sich die Versteifung. Die Schmerzen lassen nach und die Beweglichkeit kommt langsam zurück – jetzt muss die Schultermuskulatur über Physiotherapie wieder aufgebaut werden, um keine Langzeitschäden im Gelenk zu entwickeln.
Risikofaktor Frausein
Allein schon das Frausein ist ein Risikofaktor für die Frozen Shoulder.
Die Ursachen sind bislang nicht bekannt, vermutlich liegen Entzündungsprozesse zugrunde. Beobachtungen zeigen aber, dass Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Autoimmunerkrankungen oder eine Erkrankung der Schilddrüse eine Frozen Shoulder begünstigen. Genauso wie das weibliche Geschlecht und die Tatsache, dass Frauen in die Wechseljahre kommen.
"Allein schon das Frausein ist ein Risikofaktor für die Frozen Shoulder", zitiert National Geographic die Orthopädin Dr. Jocelyn Wittstein von der Duke University School of Medicine, Frauen seien vier mal häufiger betroffen als Männer, im Schnitt im Alter von 55 Jahren. Also genau in der Lebensphase, die von einer gewaltigen Hormonumstellung gekennzeichnet ist und in der die Östrogenproduktion nahe Null herunterfährt.
Die Hormone stehen unter Verdacht
Das weibliche Sexualhormon Östrogen ist ein Botenstoff mit antientzündlicher Wirkung. Ohne diesen Schutzfaktor im Körper kommt es eher zu entzündlichen Veränderungen im Bindegewebe. Gelenkschmerzen in den Wechseljahren sind daher ein weit verbreitetes Symptom, das viele nicht unbedingt auf dem Zettel haben. Das gilt für die Betroffenen selbst, aber auch Ärztinnen und Ärzte sehen nicht immer die Verbindung.
Groß angelegte Studien zu den Ursachen der Frozen Shoulder und insbesondere Zusammenhang mit dem Östrogenabfall in den Wechseljahren fehlen bislang. Als aber die Schulterspezialistin Wittstein und ihre Kollegin, die Gynäkologin Dr. Anne Ford, die Krankenakten ihrer Patientinnen genauer untersuchten, ließ sie eine Beobachtung aufmerken: Bei Frauen, die keine Hormonersatztherapie erhielten, lag die Wahrscheinlichkeit für eine Frozen Shoulder um 99 Prozent höher als bei den (wenigen) Frauen, die Hormone gegen ihre Wechseljahresbeschwerden bekamen. Zusammen mit der American Menopause Society und der American Orthopedic Society for Sports Medicine wollen die Medizinerinnen ihre Forschung nun ausweiten, um belastbare Daten zu gewinnen, die die vermutete Verbindung belegen.
Den Heilungsprozess begleiten
Das typische Kennzeichen für eine Frozen Shoulder ist, dass der Arm kaum nach außen rotiert werden kann, wenn er im rechten Winkel gehalten wird. Weil die verkleinerte Gelenkkapsel nicht auf einem Ultraschall- oder Röntgenbild erkennbar ist, sichert erst eine Magnetresonanztherapie-Aufnahme (MRT) die Diagnose.
Während der akuten Entzündungsphase dreht sich alles hauptsächlich um die Schmerzlinderung. Kortison-Spritzen oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) sind die Mittel der Wahl. Wenn der Schmerz es zulässt, sollte das Gelenk möglichst sanft mobilisiert werden. Hausärztin oder Orthopäde können dann Physiotherapie oder manuelle Therapie verschreiben. Wärme- oder Kälteanwendungen sowie Ultraschallbehandlungen können ebenfalls helfen.
In schweren Fällen, wenn diese konservativen Therapiemethoden keine ausreichende Linderung bringen, kann auch invasiv, also operativ behandelt werden, zum Beispiel durch Spülen, Dehnen oder Aufschneiden der verdickten Gelenkkapsel.
Die Hormonersatztherapie taucht als Behandlungsoption für Frauen in den Wechseljahren dagegen bislang kaum auf, trotz guter Erfolgschancen. Ein Grund dafür mag sein, dass in der Welt eines Orthopäden – trotz steigender Quote ist die Orthopädie nach wie vor eine sehr männliche Domäne, der Anteil von Ärztinnen in diesem Fachbereich liegt bei nur 14 Prozent – die Menopause und ihre Folgen nicht vorkommen. Deshalb: Ab etwa 40+ bei Gelenkbeschwerden, sei es in der Schulter, den Händen oder Knien, ruhig zur Gynäkologin oder dem Gynäkologen gehen und sich genau beraten lassen.
























:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/89/a2/89a22aa4d568ba901d4199167042e988/0122702310v2.jpeg?#)