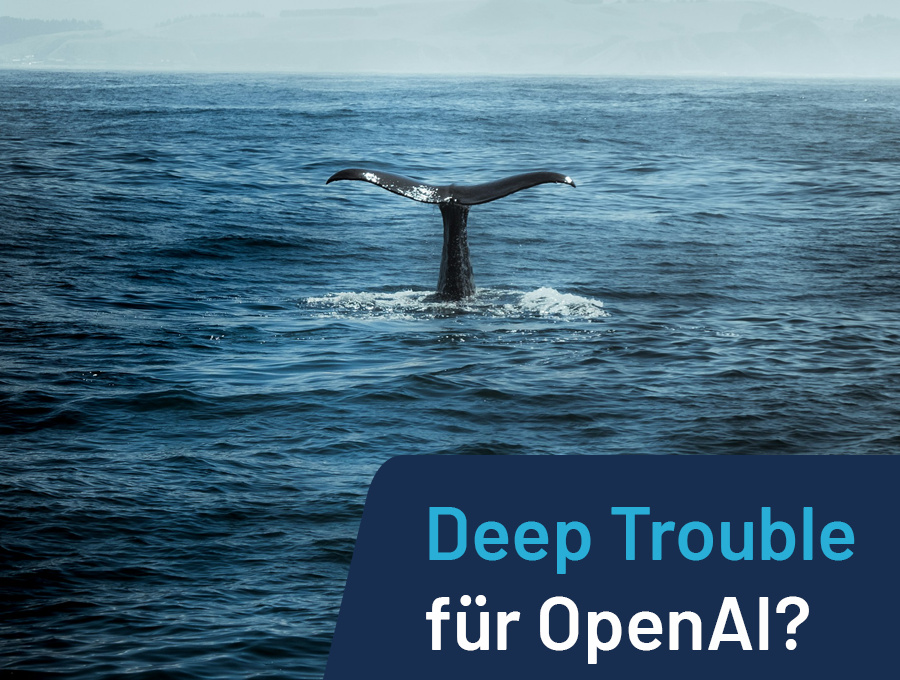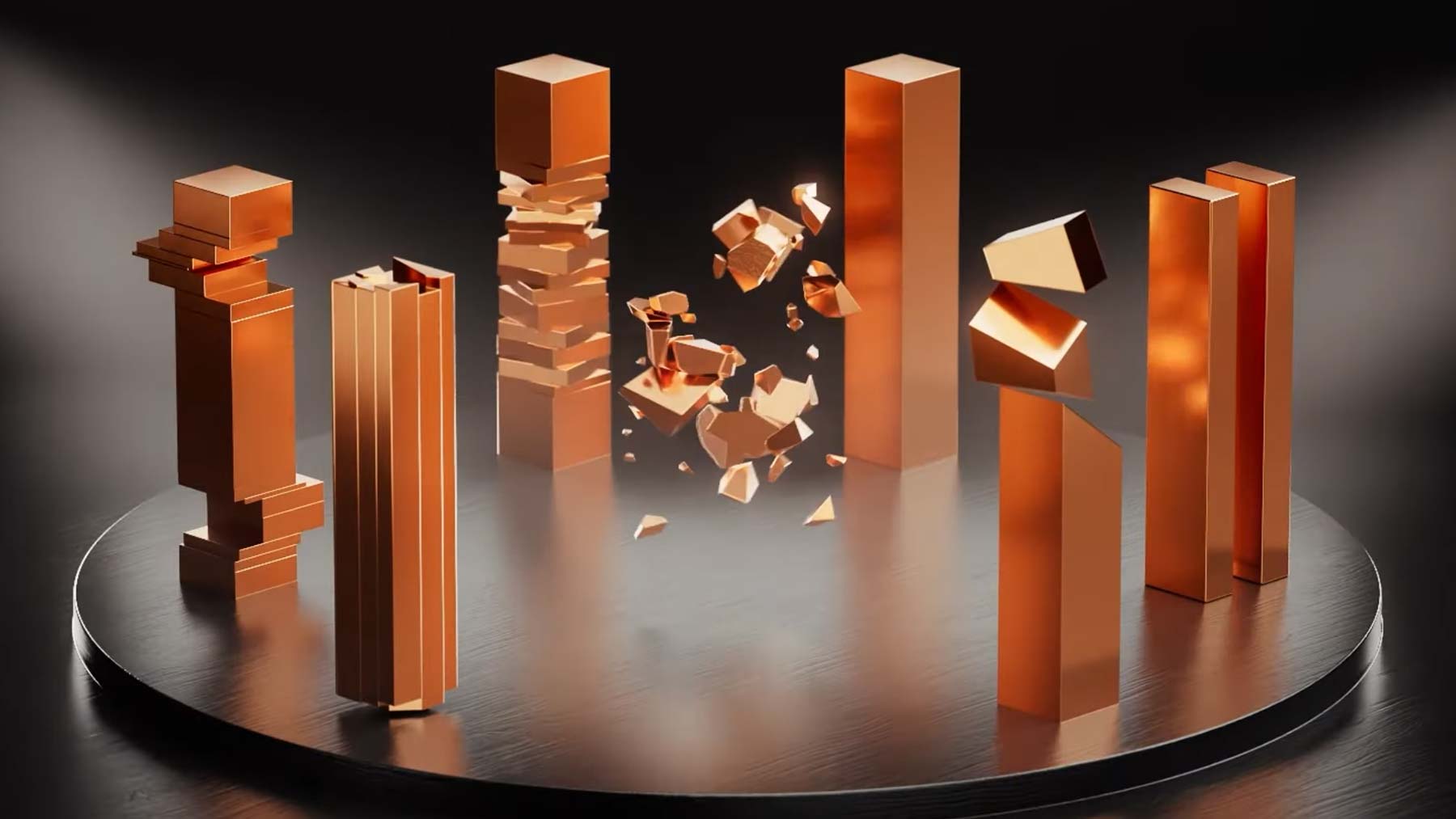Top 10: Der beste Luftreiniger im Test
Besser leben trotz Pollenallergie: Luftreiniger filtern Pollen, Feinstaub und andere Schadstoffe aus der Luft und sorgen damit für ein gesundes Raumklima, das nicht nur Allergikern zugutekommt.
Besser leben trotz Pollenallergie: Luftreiniger filtern Pollen, Feinstaub und andere Schadstoffe aus der Luft und sorgen damit für ein gesundes Raumklima, das nicht nur Allergikern zugutekommt.
In Deutschland leiden nach Angaben des Robert Koch-Instituts gut 15 Prozent der Menschen unter einer Pollenallergie. Niesattacken, Fließschnupfen und juckende Augen sind dabei nicht die einzigen Beschwerden, die Betroffene plagen. Viele schlafen schlecht, sind erschöpft und unkonzentriert. Leider verbreiten sich Allergien immer stärker. Während früher davon größtenteils Stadtbewohner betroffen waren, breiten sich Allergien nun auch auf dem Land vermehrt aus.
Zwischen 2010 und 2020 verzeichnen die Flächenstaaten im Nordosten der Republik mit bis zu 20 Prozent mehr Pollen-Allergiker den größten Anstieg. Ein Ende der Zunahme ist derzeit nicht absehbar. Im Gegenteil: Steigende Temperaturen verlängern die Vegetationsperiode der Pflanzen und sorgen damit für eine Ausdehnung der Pollen-Saison. Die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) spricht inzwischen von einer ganzjährigen Belastung durch Pollen. Saubere Luft scheint also Mangelware zu sein.
Welcher Luftreiniger ist der beste?
Der beste Luftreiniger kommt von Philips. Das liegt nicht nur an der guten Reinigungsleistung der Geräte, das schaffen schließlich andere auch. Vielmehr überzeugen die Philips-Modelle mit einem leisen Betriebsgeräusch, sodass sie auch für den Einsatz im Schlafzimmer bestens geeignet sind. Auch die App Air+ trägt zum guten Gesamteindruck bei. Sie bietet nicht nur eine leichte Bedienung der Geräte, inzwischen auch mit Zeitplänen, sondern informiert auch über gesundheitliche Gefahren, die von Feinstaub ausgehen, und hilft beim nötigen Wechsel der Filter mit anschaulichen Grafiken. Positiv ist auch, dass sich die Geräte einfach in Smart-Home-Zentralen wie Home Assistant und Homey Pro einbinden lassen und so für Automatisierungen mit anderen Smart-Home-Komponenten wie Raumluftsensoren zur Verfügung stehen. Mit deren Hilfe wird die Steuerung der Luftreiniger noch effizienter. Weitere Informationen dazu bietet unser Ratgeber Schimmel vermeiden, Immunsystem stärken: Smarte Technik für gutes Raumklima.
Nachdem die bisherigen Philips-Modelle schon längere Zeit auf dem Markt sind, gibt es nun eine neue Serie, deren Geräte kompakter und eleganter ausfallen. Davon haben wir bislang das Kombigerät aus Luftreiniger und Luftbefeuchter, den Philips Pure Protect Water AC3421 sowie den leistungsstärksten Philips-Luftreiniger AC4221 getestet. Die gezeigten Leistungen waren in jeglicher Hinsicht überzeugend, sodass sie die vorderen Plätze unserer Rangliste belegen.
Gesundheitliche Folgen von Feinstaub
Doch nicht nur Allergene wie Pollen quälen die Menschen. Die Zunahme von Feinstaub in der Atemluft sorgt für eine weitere Belastung des Immunsystems. Feinstaub (engl. Particulate Matter) ist in drei Klassen unterteilt: Man unterscheidet Partikel in den Größen 10, 2,5 und 0,1 Mikrometer. Entsprechend haben sich dafür die Bezeichnungen PM10, PM2.5 und PM0.1 international etabliert.
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verschlechtert Feinstaub die Gesundheit von Menschen. Neben eher leichten Symptomen wie Kopfschmerzen, fehlender Leistungsfähigkeit oder reduzierter Konzentrationsfähigkeit können durch Ablagerungen von Feinstaub im Lungengewebe auch schwerwiegende Erkrankungen wie Asthma, Bronchitis oder COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) ausbrechen. Auch das Herzkreislaufsystem kann durch Feinstaub in Mitleidenschaft gezogen werden. Ultrafeine Partikel können sogar über die Lungenbläschen in die Blutbahn gelangen und so andere Organe befallen.
Laut WHO führen bereits kurzzeitig erhöhte Feinstaubkonzentrationen zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen. Demnach sterben jährlich 3,2 Millionen Menschen vorzeitig an Krankheiten, die auf die Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Aber auch geringere Konzentrationen sind über einen längeren Zeitraum gesundheitsschädlich. Forscher gehen davon aus, dass in Verbindung mit SARS-CoV-2 etwa 15 Prozent aller weltweiten Todesfälle der Corona-Pandemie auf eine langfristige Exposition von Luftverschmutzung zurückzuführen sein könnte. In Europa soll dieser Anteil sogar 19 Prozent betragen und in Ostasien beachtliche 27 Prozent.
2021 hat die WHO die Grenzwerte für Luftschadstoffe verschärft. Sie lagen schon bis dahin unter denen der EU. Während die WHO etwa für PM2.5 einen Grenzwert von 10 µg/m³ empfahl, den sie 2021 auf 5 µg/m³ gesenkt hat, liegt der Grenzwert der EU bei 25 µg/m³. Doch die EU will nachziehen, auch wenn sie dabei nicht den Empfehlungen der WHO folgt. Ab 2030 soll in der EU für PM2.5 ein Grenzwert von 10 µg/m³ gelten. Für kleinere Partikelgrößen gibt es derzeit noch keine Grenzwerte, obwohl diese viel gefährlicher als große Partikel sind. Und das, obwohl die WHO davon ausgeht, dass es keine Feinstaubkonzentrationen gibt, die nicht gesundheitsschädlich sind.
| Grenzwerte für Schadstoffbelastung | ||||
| Luftschadstoff | WHO 2005 | WHO 2021 | EU-Grenzwert (aktuell) | EU ab 2030 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 40 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 40 µg/m³ | 20 µg/m³ |
Während in der Außenluft Feinstaub durch Verkehr, Kraftwerke und Industrie entsteht, sorgt in Innenräumen vorwiegend das Zubereiten von Speisen für eine hohe Feinstaubbelastung. Die Feinstaubkonzentration sinkt natürlich mit der Zeit. Aber mit einem Luftreiniger gelingt die Absenkung deutlich schneller. Vor allem im Winter, wenn weniger gelüftet wird, sind die Geräte nützlich.
So arbeiten Luftreiniger
Das Funktionsprinzip von Luftreinigern ist simpel: Ein Ventilator saugt Umgebungsluft an, die durch die Luftfilter gereinigt wird und verteilt sie im Raum. In der Regel sind in Luftreinigern drei Filter (Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter) montiert, die 99,97 Prozent der Partikel erfassen. HEPA ist die Abkürzung für High Efficient Particulate Air (filter), was sich etwa mit hocheffizienter Partikelfilter übersetzen lässt. HEPA-Kennzeichnung erhalten Filter, wenn sie einen normierten Abscheidegrad erreichen. In der Regel verwenden die Luftreiniger einen HEPA-Filter der Klasse H13, der einen Abscheidegrad von 99,95 Prozent erreicht.
Die Luftreinigung funktioniert wie folgt: Der sogenannte Primärfilter entzieht der Luft Staub, Haare und andere große Partikel wie Baumwollfasern. Der HEPA-Filter reinigt die Luft von Partikeln ab einer Größe von 0,3 Mikrometer. Hierzu zählen etwa Staub, Feinstaub, Pollen, Hautschuppen von Tieren und Rauch. Und der Aktivkohlefilter befreit die Luft von unangenehmen Gerüchen, die etwa beim Kochen entstehen, Formaldehyd und anderen flüchtigen organischen Verbindungen. Die in dieser Bestenliste aufgeführten Geräte verfügen über Filter, die nach diesem Prinzip arbeiten und von unabhängigen Institutionen wie ECARF oder TÜV überprüft und zertifiziert wurden. Dazu gehören etwa die beiden Philips-Luftreiniger AMF870 und AC3033/10, der Jya Fjord Pro, die beiden Smartmi-Modelle Air Purifier 2 und E1, der Xiaomi Smart Air Purifier 4, der Beurer LR 401 und der Levoit Vital 200S.
Einige Varianten wie die Xiaomi-Luftreiniger 4 und 4 Pro können darüber hinaus Luft mit negativen Ionen anreichern. Diese verbinden sich mit Partikeln, damit sie die Luftreiniger besser filtern können. Dabei entsteht allerdings auch Ozon, das als gesundheitsschädlich gilt. Im Testbetrieb hat unser Luftanalysator Air Q (Ratgeber) allerdings keinen Anstieg von Ozon registriert. Sollten dennoch Beschwerden auftreten, kann man die Funktion einfach ausschalten. Der Smartmi Air Purifier 2 und der Beurer LR 401 sterilisieren mithilfe von UV-C-Licht zudem gefährliche Viren und Bakterien. Aber auch die anderen Luftreiniger filtern Aerosole und reduzieren die Ansteckungsgefahr durch gefährliche Viren.

Reinigungsleistung in der Praxis
Was die Reinigungsleistung angeht, überzeugen alle die in dieser Bestenliste aufgeführten und von uns getesteten Luftreiniger. Im Schlafzimmer reinigen sie die Luft effektiv: Unangenehme Gerüche menschlicher Ausdünstungen wurden vom später zu Bett gehenden Bewohner nicht wahrgenommen. Im kleinen Büro sorgen sie für ein angenehmes Arbeitsklima, sodass trotz längerer Nutzung ohne Lüftung nicht der Eindruck von verbrauchter Luft entstand.
Und auch im Wohnzimmer mit offener Küche sind Gerüche vom Kochen schneller verflogen als ohne Luftreiniger. Interessant in diesem Zusammenhang: Das Zubereiten von Bratwürsten in einer Heißluftfritteuse ließ den PM2.5-Wert von etwa von 5 auf 600 ppm hochschnellen – etwa vergleichbar mit dem Qualm einer Zigarette.

Lüften muss man natürlich trotzdem, da verbrauchte Luft sich auch in einer höheren CO₂-Konzentration zeigt. Diese wiederum erkennen die Geräte nicht, dafür aber Luftqualitätsmesser wie Airthings View Plus, Awair Element und Air-Q Pro (Bestenliste). Doch frische Luft von außen sorgt nicht nur für einen höheren Sauerstoffanteil in der Raumluft, sondern auch dafür, dass je nach Wetterlage Schadstoffe in den Innenraum gelangen. Das ist vorwiegend im Winter häufig der Fall, kann aber auch im Sommer passieren, wenn etwa durch eine südliche Anströmung die Luft jede Menge Saharastaub enthält. So registriert der Luftanalysator Air-Q Pro an mehreren Tagen beim Lüften eine Zunahme der Feinstaubbelastung. Nachdem die Balkontür geschlossen wurde, reinigten die Geräte die Raumluft innerhalb weniger Minuten und zeigten wieder die zuvor gemessenen Werte an. Einen aktuellen Überblick zur Belastung von Feinstaub und Pollen bietet die App Air Matters, mit der man auch die Philips-Luftreiniger steuern kann. Auch das Umweltbundesamt bietet mit der App Luftqualität Daten zur Schadstoffbelastung. Diese lassen sich bequem per Browser abrufen. Airgradient (Test) stellt ebenfalls eine Karte mit Daten zur Luftverschmutzung bereit.
Weniger Allergie-Symptome
Gesundheitliche Verbesserungen stellten sich bei einem Bewohner ein, der unter einer leichten chronischen Bronchitis leidet, die sich vorwiegend durch häufigeres Husten bemerkbar macht. Der Husten reduzierte sich nach etwa zwei Tagen. Beide Bewohner empfanden beim Atmen die Luft als „frischer“. Und auch eine Allergikerin, die einen Xiaomi-Luftreiniger im Schlafzimmer nutzt, schläft nun erholsamer als ohne das Gerät.
Auswahlkriterien für Luftreiniger: Reinigungsleistung
Die Größe des Raumes spielt bei der Auswahl eines Luftreinigers eine zentrale Rolle. Neben den von den Herstellern empfohlenen Raumgrößen orientieren sich Interessierte besser an der Clean Air Delivery Rate (CADR) der jeweiligen Modelle. Der CADR-Wert gibt an, wie viel Raumluft innerhalb einer Stunde gereinigt wird. Hier sollte man allerdings bedenken, dass sich die angegebenen Werte auf die Maximal-Leistung der Geräte beziehen. Die Reinigungsleistung auf niedriger Stufe, etwa im Schlafmodus, ist deutlich geringer.
Daher sollte man die Raumgrößenempfehlungen der Hersteller in etwa halbieren, da sich diese Angaben meist auf den stärksten Betriebsmodus mit der größten Lautstärke beziehen. In der Praxis dürften die meisten Anwender diesen aufgrund der großen Lautstärke jedoch meiden. Und deshalb ist es ratsam, einen etwas stärkeren Luftreiniger zu wählen, sodass dieser auch bei niedrigster Lüfterdrehzahl noch die Luft in einer angemessenen Zeit reinigen kann.
Leistungsaufnahme von Luftreinigern
Für die Auswahl eines Luftreinigers sind des Weiteren die Leistungsaufnahme sowie die Kosten für neue Filter von Bedeutung. Grundsätzlich ist die Leistungsaufnahme bei den Geräten generell nicht hoch. Mit knapp 60 Watt benötigt der schon etwas ältere Smartmi-Luftreiniger Jya Fjord Pro bei maximaler Lüfterdrehzahl am meisten Energie. Das brandneue Philips-Top-Modell AC4221 mit etwas höherer Reinigungsleistung kommt hingegen nur auf 47 Watt. Im Stand-by beträgt die Leistungsaufnahme zwischen 0,6 und knapp 2 Watt. Im Schlafmodus mit niedrigster Lüfterdrehzahl sind es maximal 5 Watt.
| Luftreiniger | Philips AC4221 | Philips AC3421 | Philips AMF870 | Philips AC3033/10 | Switchbot Luftreiniger F6 | Jya Fjord Pro | Smartmi Luftreiniger 2 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 | Levoit Vital 200S | Morento HY4866-WF | Beurer LR 401 |
| Zimmergröße | 156 m² | 78 m² | 70 m² | -135 m² | 33 m² | 38-66 ㎡ | 26-45 ㎡ | 28-45 ㎡ | 35-88 m² | - 100 m² | -69 m² |
| CADR Partikel | 600 m³/h | 300 m³/h | 270 m³/h | 520 m³/h | 400 m³/h | 550 m³/h | 333 m³/h | 400 m³/h | 416 m³/h | 300 m³/h | 266 m³/h |
| CADR TVOC | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 250 m³/h | 100 m³/h | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Besonderheit | - | Luftbefeuchter integriert | Heizlüfter integriert | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PM2.5 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| TVOC | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| PM10 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| Standby | 1,3 Watt | 1,1 Watt | 1,9 Watt | 1,4 Watt | 0,6 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 1,4 Watt | 0,6 Watt | 1,7 Watt | 0,7 Watt |
| Schlafmodus | 2,6 Watt | 2,8 Watt | 5 Watt | 3,9 Watt | 1,9 Watt | 2,9 Watt | 3,6 Watt | 3,5 Watt | 3,2 Watt | 3,7 Watt | 1,7 Watt |
| Maximal | 47,4 Watt | 36,1 Watt | 45 Watt | 47,5 Watt | 36,7 Watt | 61,9 Watt | 37,2 Watt | 28,3 Watt | 40,8 Watt | 45 Watt | 37,8 Watt |
Filterkosten
Die Abnutzung des Filters ist von der Nutzungszeit und der Luftqualität am Standort abhängig. In der Regel müssen die Filter nach 6 bis 12 Monaten getauscht werden. Die Kosten für die Filter sind je nach Hersteller und Reinigungsleistung des Geräts unterschiedlich. Für den Filtertausch beim Testsieger Philips AC4221 mit einer Reinigungsleistung von 600 m³/h (CADR) muss man knapp 80 Euro bezahlen, während dieser beim Philips AC3421 mit einem CADR-Wert von 300 m³/h nur 36 Euro kostet. Wer bei den Filterkosten für Philips-Luftreiniger etwas sparen möchte, kann auch zu Lösungen von Drittherstellern wie Comedes greifen.
Während die Filterkosten bei den Luftreinigern in der Regel zwischen 30 und 80 Euro liegen, gibt es aber auch Ausnahmen. Das betrifft hauptsächlich Auslaufmodelle wie die Philips-Luftreiniger AC3033 und AC4236, aber auch die Smartmi-Modelle Luftreiniger 2 und Jya Fjord Pro. Hier muss man teilweise deutlich über 100 Euro für den Filtertausch einkalkulieren. Während man bei den stark verbreiteten Philips-Luftreinigern auf Alternativen von Comedes ausweichen kann, ist das bei Smartmi und anderen chinesischen Modellen mangels Angeboten hingegen nicht möglich.
Luftgütesensoren
Mit Luftanalysatoren oder Luftgütesensoren können Anwender den Betrieb von Luftreinigern optimieren – etwa, wenn der Automatikmodus des Luftreinigers zu laut oder zu wenig effizient arbeitet. Hierfür müssen die Geräte allerdings in Smart-Home-Zentralen (Bestenliste) wie Home Assistant (Testbericht), Homey Pro (Testbericht), Samsung Smartthings (Testbericht) oder Apple Homekit (Testbericht) eingebunden werden. Doch das ist leichter gesagt als getan. So bietet der Air-Q Pro für aktuell 569 Euro eine direkte Anbindung nur zu Homey Pro und einigen Open-Source-Lösungen wie Open HAB, Iobroker und Home Assistant. Und über Umwege wie Homebridge oder Homey Pro findet das Gerät auch Anschluss an Apple Homekit.
Und auch der Luftreiniger muss kompatibel mit der verwendeten Smart-Home-Zentrale sein. Im Test hat die Steuerung der Philips-Luftreiniger über Home Assistant und Homey Pro in Kombination mit dem Air-Q Pro problemlos funktioniert.
Mit Awair Element steht ein weiterer, leistungsfähiger Luftqualitätsmesser zur Verfügung. Er bietet zwar nicht so viele Sensoren wie der Air-Q Pro, ist aber dafür mit aktuell 160 Euro deutlich günstiger. Awair Element erfasst mit CO₂, TVOCs, PM2.5, sowie Temperatur und Luftfeuchte wesentliche Daten zur Luftqualität. Dank APIs für die lokale oder Cloudnutzung lässt sich das Gerät in leistungsfähige Smart-Home-Zentralen wie Homey Pro (Testbericht) oder Home Assistant (Testbericht) einbinden und für Automatisierungen, etwa zur Steuerung von Luftreinigern, verwenden.
Wer einen Luftreiniger in Verbindung mit einem leistungsfähigen Raumluftsensor unter einem Smart-Home-System verwendet, verlängert durch eine Optimierung der Nutzungszeit zudem die Lebensdauer der Filter und spart damit Kosten.
Fazit
Wer sich vor den Auswirkungen von Pollen schützen und für ein gesundes und angenehmes Raumklima ohne Feinstaub sorgen möchte, greift zu einem leistungsstarken Luftreiniger. Gerade im Winter, wenn seltener gelüftet wird und die Außenluft häufig eine höhere Schadstoffkonzentration als im Sommer aufweist, sind die Geräte besonders nützlich.
Die in dieser Bestenliste aufgeführten Luftreiniger haben sich in der Praxis bewährt. Sie sind dauerhaft im Einsatz und reduzieren effektiv die Schadstoffbelastung der Raumluft, was durch Messwerte unserer Raumluftsensoren Air-Q Pro und Awair Element belegt wird. Aber noch wichtiger als Messwerte: Allergiker leiden weniger unter den schädlichen Auswirkungen von Pollen und anderen Schadstoffen. Grundsätzlich ist saubere Luft für ein gesundes Raumklima wichtig. Trotz Luftreiniger sollte man aber auch ans Lüften denken. Denn CO₂ können die Geräte nicht in Sauerstoff umwandeln.
Optimal ist es, wenn man den Betrieb der Luftreiniger anhand realer Messwerte von leistungsfähigen Luftsensoren wie dem Air-Q steuert und somit dafür sorgt, dass der Luftreiniger nur dann aktiv wird, wenn dafür tatsächlich Anlass besteht. Das senkt nicht nur die Stromkosten, sondern verlängert auch die Nutzungsdauer der Filter. Detaillierte Informationen zu diesem Thema bieten die Beiträge Schimmel vermeiden, Immunsystem stärken: Smarte Technik für gutes Raumklima und Top 10: Der beste Raumluftsensor fürs Smart Home im Test.