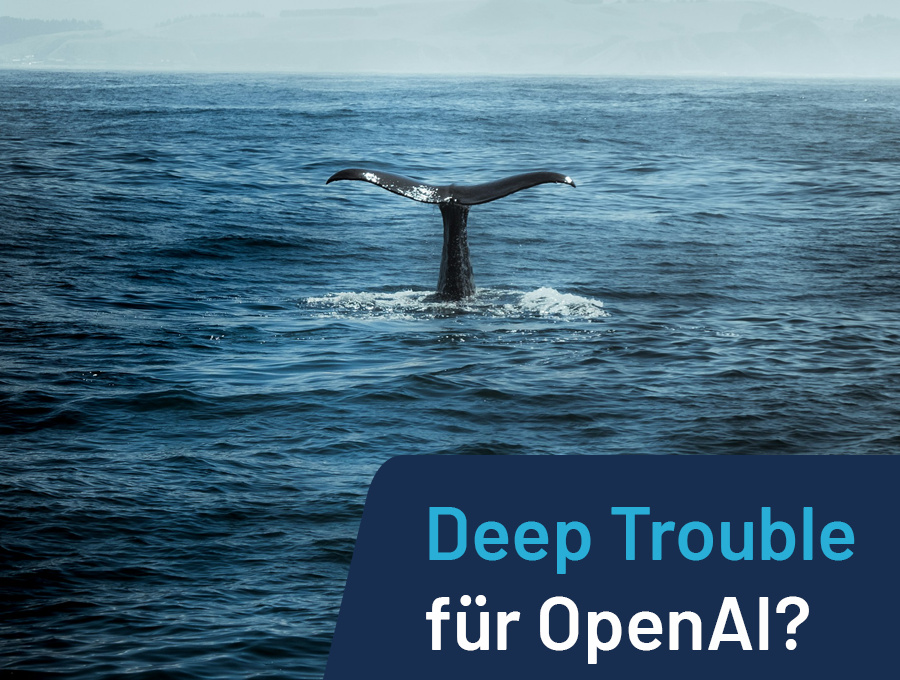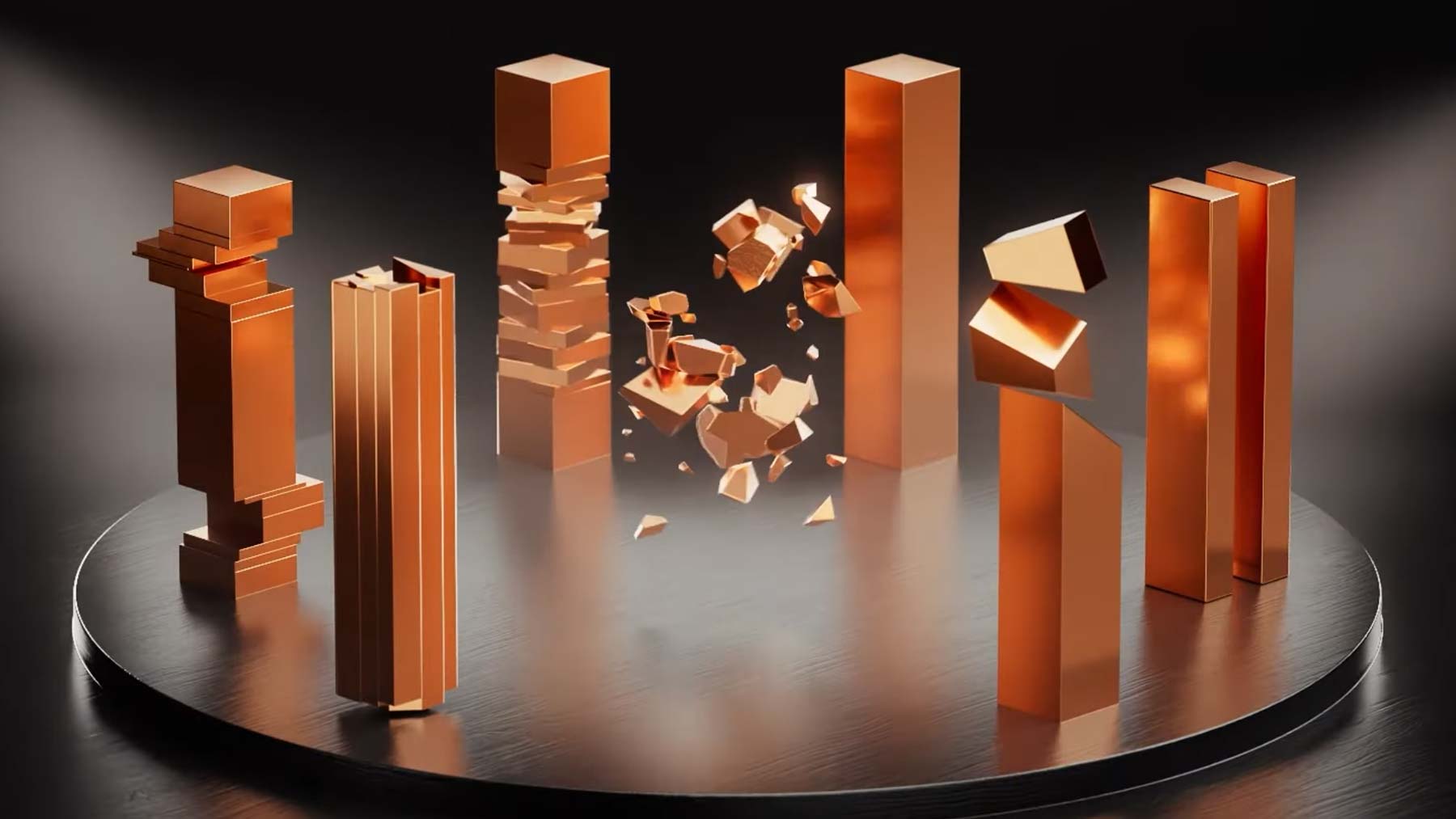Musikgeschichte: Als sich Paare noch singend trennten
Vor 500 Jahren war die Musikwelt eine gänzlich andere als heute. Und doch hatte sie viel mit einem aktuellen Phänomen gemein: den Sozialen Medien

Vor 500 Jahren war die Musikwelt eine gänzlich andere als heute. Und doch hatte sie viel mit einem aktuellen Phänomen gemein: den Sozialen Medien
Man sang und musizierte, mehr oder weniger professionell. An Adelshöfen, in bürgerlich-städtischen und studentisch-universitären Kreisen. Im Grunde tun wir das auch heute noch – jedoch hatte die Musik im 15. und 16. Jahrhundert noch einen anderen Nutzen. Forschende der Universitäten Bayreuth und Basel beschrieben nun die sozialen Aspekte der damaligen Liedkultur des deutschen Sprachraums.
Cordula Kropik ist Professorin für germanistische Mediävistik. Sie befasst sich mit deutscher Sprache und Literatur des Mittelalters bis zur frühen Neuzeit. Gemeinsam mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Rosmer und anderen Expertinnen aus Germanistik, Niederlandistik und Musikwissenschaft analysierten sie alte Flugblätter und Liederbücher, um herauszufinden, welche Funktion Lieder für frühere Gesellschaften hatten. Die Ergebnisse finden sich zusammengefasst im Sammelband Geselliger Sang: Poetik und Praxis des deutschen Liebesliedes im 15. und 16. Jahrhundert.

© akg-images
Lieder aus dieser Zeit wurden nicht nur von vielen Menschen gehört und mitgesungen, sondern vermutlich meist kollektiv verfasst. "Deshalb sprechen wir vom Geselligen Sang", erklärt Kropik. Urheberrechte gab es noch nicht. Musiker nahmen Laientexte, legten eine Melodie darüber und schrieben sie auf. Jeder konnte sich ein Lied aneignen und verändern. Vergleichbar mit dem Prinzip: "Post, like and share". "In diesem Sinne könnte man Lieder als Social Media des 15. und 16. Jahrhunderts bezeichnen."
Musik eng in soziale Zusammenhänge eingebunden
Die Lieder verbreiteten sich von Mund zu Mund, wurden abgeschrieben und auch bereits gedruckt: Papier war billig, Einblattdrucke mit Liedern gab schon vor 1500, 1512 erschien das erste gedruckte Liederbuch, und Händler verkauften Flugblätter mit Musik darauf auf Jahrmärkten.

© Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
Heute funktionieren Hits für die breite Masse und sprechen Stereotype an. Damals waren Lieder jedoch eng in soziale Zusammenhänge eingebunden. Menschen sangen Lieder unter anderem, um ihre Liebsten direkt anzusprechen. "Manchmal machte man auch in einem Lied mit jemandem Schluss", erklärt Kropik, "oder sang ein Lied als Neujahrsgruß." Dabei bezogen sich manche Quellen auf die Namen der Besungenen: Es tauchten zum Beispiel Initialen einer Person im Lied auf und machten die Musik sehr persönlich.
Außerdem sprachen Lieder bestimmte soziale Gruppen an, sodass einige Dichter oder Komponisten in bestimmten Kreisen gehört wurden, darüber hinaus aber wenig bekannt waren. Heute wären sie Stars ihrer jeweiligen Filterblasen. In vielen Fällen blieben die Urheber ohnehin unbekannt, weil so viele Münder die Musik weitertrugen, dass sie sich immer wieder veränderte.
Plötzlich tauchten Lieder in völlig anderen Szenarien wieder auf. "Wir haben ein Lied untersucht, dessen Komposition aus den 1520er-Jahren stammte. Der Text war noch älter", sagt Kropik. Die Komposition kam von einem damals sehr bekannten Hofkomponisten Kaiser Maximilians. Die Forschenden schlossen daraus: Das Stück wurde im höfischen Kontext gespielt. Genau dieses Lied fanden sie jedoch um 1600 in einem jiddischen Liederbuch, von rechts nach links in hebräischen Buchstaben geschrieben, wieder.
"Unsere Ergebnisse schaffen die Grundlage für eine Neubewertung der Liedkultur des 15. und 16. Jahrhunderts"
"Es war nicht besonders wichtig, wer das Lied geschrieben hatte. Die Musik war für alle da", sagt Kropik. "Man musste nicht perfekt singen, musizieren oder Texte schreiben können." Heute ist Musik durch Urheberrechte und Plattenfirmen meist an die Kunstschaffenden gebunden. Dadurch ist sie eher zu etwas geworden, das wir passiv konsumieren. "Man kann es sich ungefähr so vorstellen, dass die Menschen damals so Musik machten, wie Laien heute YouTube-Videos produzieren – auch wenn sie das nicht gelernt haben."
Viele bisherige literaturwissenschaftliche Untersuchungen missachteten Lieder aus dem "Geselligen Gesang" genau aus diesen Gründen: Unbekannte Urheberschaft, verschmierte und literarisch anspruchslose Texte. "Unsere Ergebnisse schaffen die Grundlage für eine Neubewertung der Liedkultur des 15. und 16. Jahrhunderts", sagt Kropik. Vom Image der unbedeutenden Liedtexte hin zu Musik, die im Alltag und im sozialen Kontext durchaus von Bedeutung war. "Abgesehen davon sind viele der Texte nicht so anspruchslos, wie sie auf den ersten Blick erscheinen."

© Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichte eine intensive Untersuchung der Lieder: "Die Erkenntnis, dass es früher ganze Communitys gab, die untereinander Liedtexte weitergegeben und sie aufgeführt haben, war spannend. Durch die Töne lebt die Sprache plötzlich", sagt Kropik. Sie sei fasziniert von der Vorstellung, wie sich junge Menschen traurige oder fröhliche Nachrichten mit Gesang überbrachten, wie sie anzügliche Gedanken durch Lieder mitteilten und diese immer weiterdichteten. Dabei begleitete die Laute, ähnlich einer Gitarre, viele damalige Stücke.
Die Laute spielt auch eine Rolle bei dem Projekt E-LAUTE, bei dem die gesamte deutsche Lautentabulatur zusammengetragen werden soll – auf den Schriften sind keine Musiknoten festgehalten, sondern die Griffe auf der Laute. Gemeinsam mit Wiener und Schweizer Kollegen und Kolleginnen will Kropik die Tabulatur so aufbereiten, dass man die Stücke auch heute wieder nachspielen kann. Sie werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt, sodass die Klänge und die Sprache der Renaissance nicht verloren gehen.