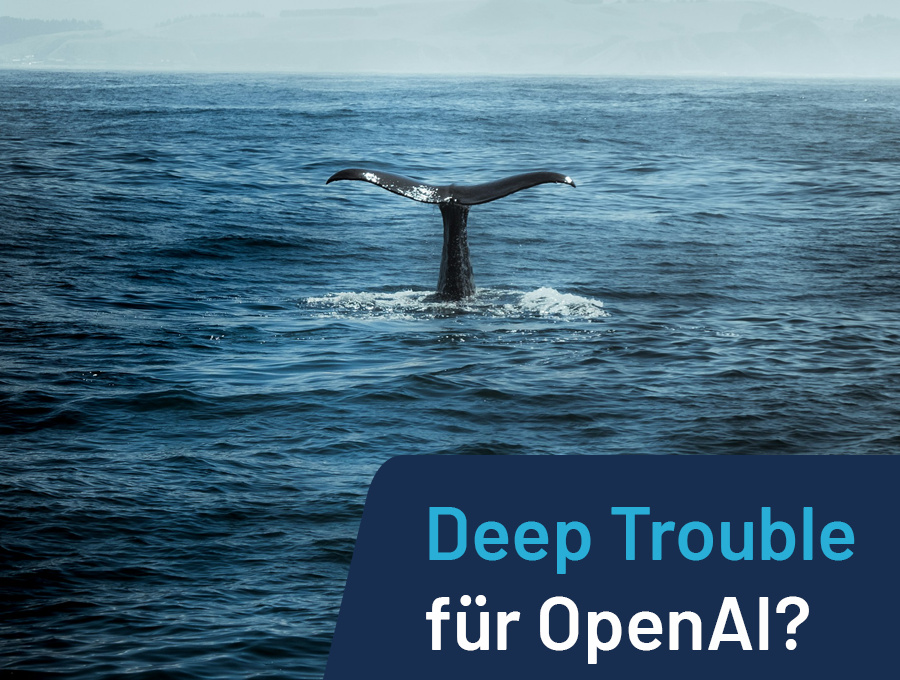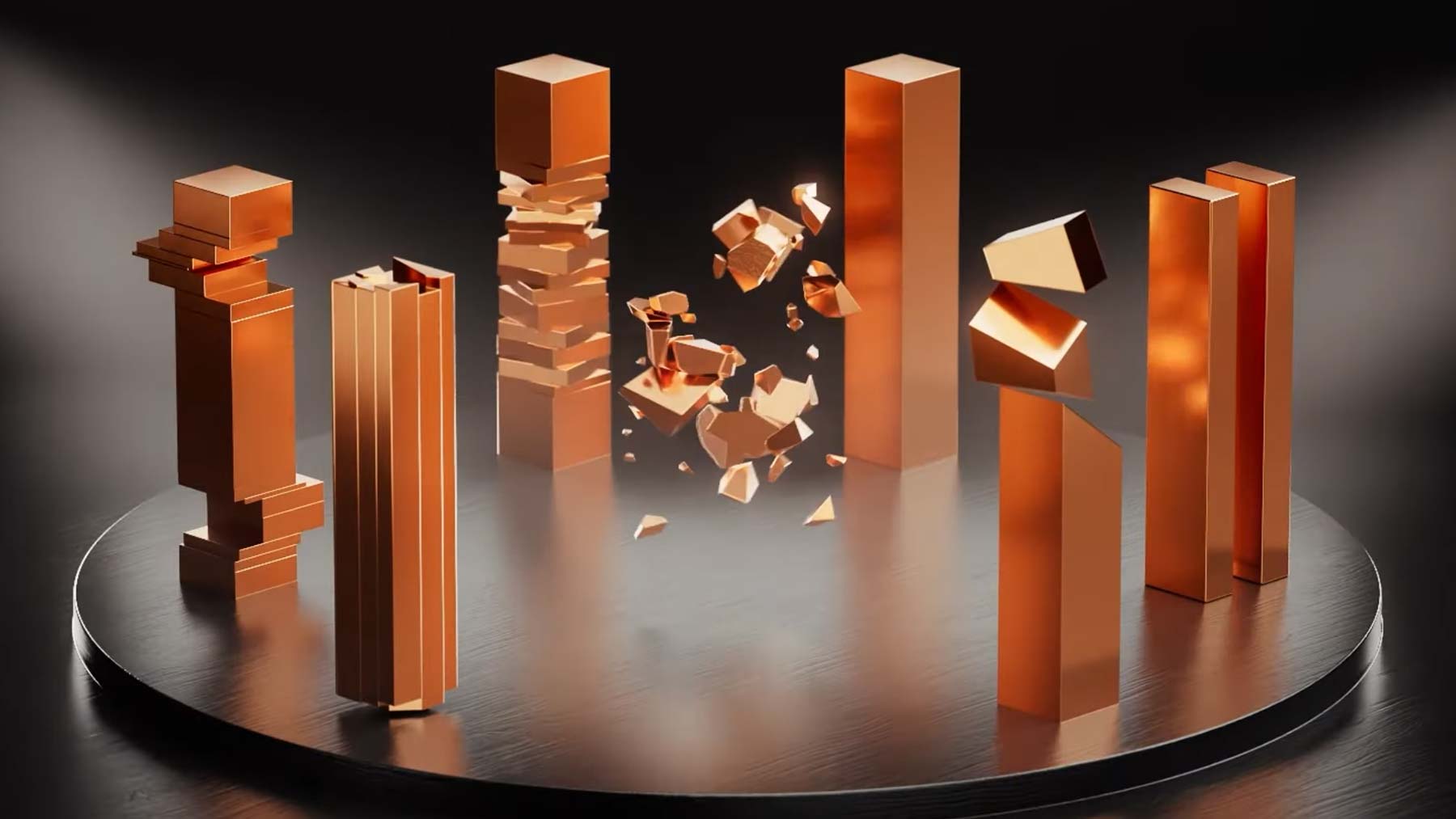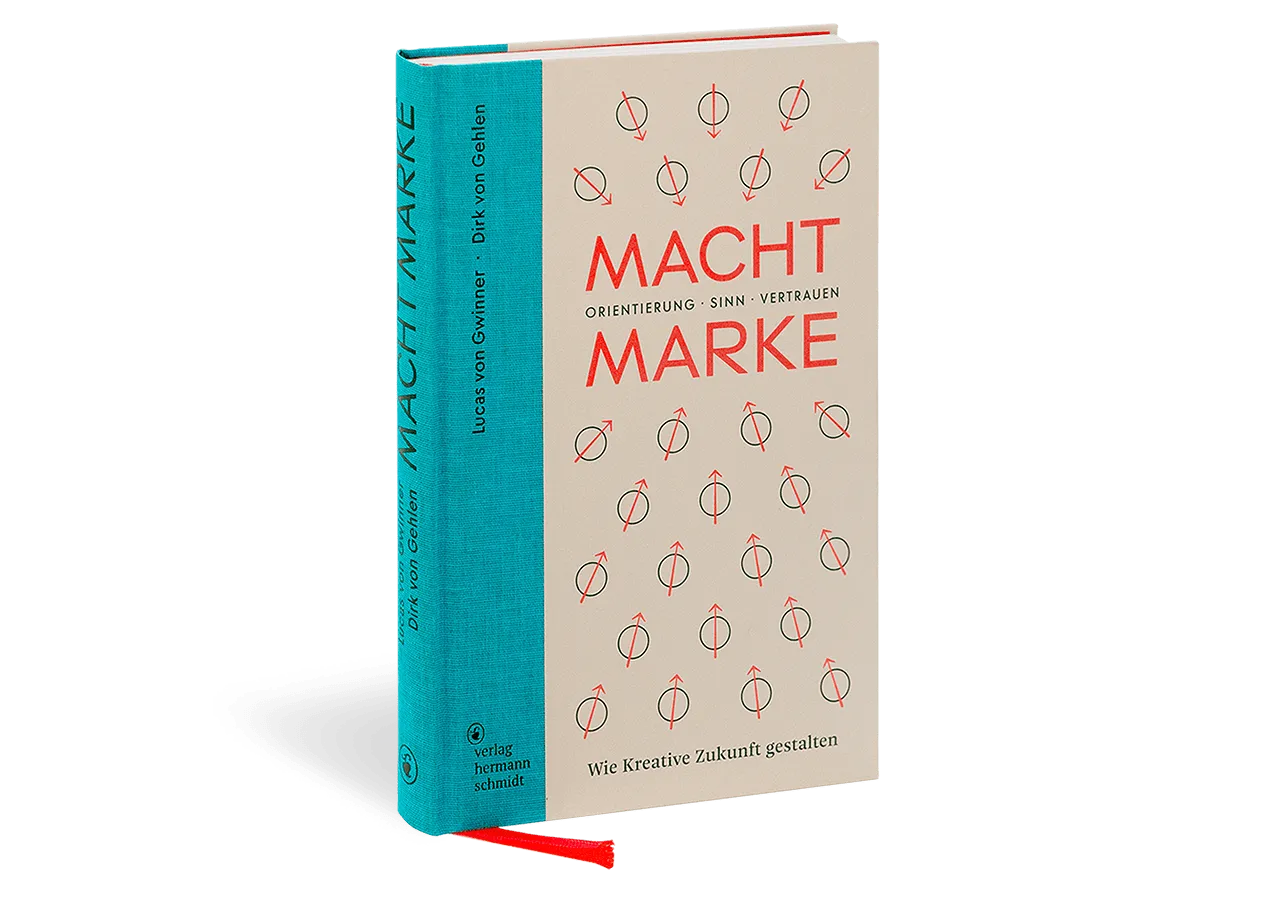Das Handwerk der politischen Kommunikation: Was ist nur mit der Union los?
Öffentliche Kommunikation ist ein Tätigkeitfeld, das immer komplizierter zu werden scheint. Immer neue Kanäle und Anforderung verlangen Aufmerksamkeit und lenken ein wenig davon ab, dass der Kern von Kommunikation einfachen handwerklichen Regeln folgt. Es geht um Botschaften, die an bestimmte Zielgruppen gesendet werden sollen – und um die Erkenntnis, dass dies häufig nicht nur durch […]
Öffentliche Kommunikation ist ein Tätigkeitfeld, das immer komplizierter zu werden scheint. Immer neue Kanäle und Anforderung verlangen Aufmerksamkeit und lenken ein wenig davon ab, dass der Kern von Kommunikation einfachen handwerklichen Regeln folgt. Es geht um Botschaften, die an bestimmte Zielgruppen gesendet werden sollen – und um die Erkenntnis, dass dies häufig nicht nur durch das passiert, was ausgesprochen oder gesagt wird, sondern vor allem über Handlungen und Taten (show, don’t tell).
Die Aufgabe guter (im Sinne von geglückter) Kommunikation ist es, einen Schritt zurückzutreten, Emotionen rauszunehmen und eine! möglichst verständliche Antwort auf die Frage zu geben: Welche Botschaft soll an wen gesendet werden? Oder noch einfacher: Wofür möchtest du beim wem bekannt sein?
Wenn man diesen Maßstab anlegt, wirft das Verhalten der Union in dieser Woche zumindest große Fragen auf. Und damit meine ich nicht den Inhalt des 5-Punkte-Plans oder die Art und Weise, wie dieser eine Mehrheit fand. Ich meine vor allem die politische Kommunikation der Partei, die bis zu dieser Woche wie der sichere Sieger der kommenden Bundestagswahl aussah. Ich frage mich: Was genau ist kommunikationsstrategisch bei der Union eigentlich los? (Foto: Unsplash)
Der Versuch einer Analyse in drei Punkten:
Zielgruppe
Nehmen wir mal die Perspektive derjenigen ein, die erreicht werden sollen. Merz hatte 2018 angekündigt, die Wählerschaft der AfD halbieren zu wollen. Die Zielgruppe seiner aktuellen Politik sind also Menschen, denen die Brandmauer eh egal war. Die Debatte darum, die Emotionen von Linken, Grünen und SPD kann Merz also eigentlich ignorieren – mehr noch: sie könnte ihm eigentlich nutzen, um sich in der Zielgruppe, der er gerade eine Botschaft senden wollte, bekannt und sichtbar zu machen. Im Sinne der negativen Aufmerksamkeit könnte die Union von der aktuellen Abstimmung sogar profitieren, wenn ihr dabei nicht zwei katastrophale Fehler unterlaufen wären, auf inhaltlicher und formaler Ebene.
Die Menschen, die die Union erreichen wollte, wünschen sich politisches Kalkül im Sinne von Donald Trump. Man kann von starker Führung, Verhandlungsgeschick oder sogar Gerissenheit sprechen. Diese Botschaft wollte Merz senden, als er im Stile Trumps Ankündigungen für den ersten Tag seiner Amtszeit vesprach, das Wort Richtlinienkompetenz einsetzte und sich als Macher präsentierte. Wenn es aber darum geht, dieses Bild zu senden, muss man sich fragen: Kann sich irgendwer vorstellen, dass Donald Trump im Anschluss an eine Debatte, die ihm eine Mehrheit gesichert hat, sein Bedauern darüber ausdrückt? Genau das hat Merz getan. Und das war ein Fehler. Nicht, weil ich finde, er solle sich an Trump orientieren, sondern weil er seiner gewünschten Zielgruppe die deutliche Botschaft gesendet hat: Ich will das eigentlich gar nicht wirklich.
Für eine Zielgruppe, die in einer unübersichtlichen Welt Eindeutigkeiten wünscht, ist diese Botschaft natürlich fatal. Und zwar völlig unabhängig von den Inhalten, die Merz hat abstimmen lassen, hat er hier das genaue Gegenteil dessen signalisiert, was die Zielgruppe sich wünscht: keine starke Hand, kein klarer Plan, keine deutliche Führung. Mehr noch: Er hat sich aus welchen Gründen auch immer zu einem Schritt hinreißen lassen, der ihn völlig unnötig vor der Wahl in Erklärungsnöte bringt.
Zeitpunkt
Politische Kommunikation zeigt sich nicht nur an dem, was gesagt wird, sondern vor allem an dem, was nicht gesagt wird. Überlicherweise werden deshalb heikle Themen VOR einer Wahl uneindeutig beantwortet – um keine Optionen zu verbauen. Allein deshalb ist es sehr unüblich, dass die Merz-Union wenige Tage vor der Bundestagswahl eine Abstimmung im Parlament herbeigeführt hat, die sie zur Positionierung in der heiklen Frage im Verhältnis zur AfD zwingt. Man muss das nochmal festhalten: Dass Merz sich dazu verhalten muss, ist nicht externen Umständen geschuldet, sondern dem Verhalten einer einzigen Person: Friedrich Merz.
Ohne Not hat er nicht nur den Blick auf das Thema gelenkt, sondern auch eine namentliche Abstimmung herbeigeführt. Die Botschaft lautet also: im Zweifel gibt es ein Zusammenwirken mit der AfD. Das kann man inhaltlich falsch finden, was aber aus kommunikationsstrategischer Perspektive der Union überhaupt nicht verstehen kann: Warum in aller Welt sendet sie diese Botschaft VOR der Wahl? Was will sie damit signalisieren?
Zwei Botschaften stecken in diesem – freiwillig und ohne Not herbeigeführten – Verhalten: den eher liberalen Wählern, die Merkel mochten und sich eine klare Abgrenzung zur AfD wünschen, sendet Merz die Botschaft, dass es Situationen gibt, in denen man sich darauf nicht mehr verlassen kann. Vielleicht würde diese Zielgruppe das sogar akzeptieren, aber doch nicht zu diesem Zeitpunkt. Wer eine konservative Politik ohne AfD wünscht, wird sich jetzt fragen müssen: Soll ich nicht doch besser Olaf Scholz oder Robert Habeck wählen?
Und wer zu der oben beschriebenen Zielgruppe derjenigen angehört, die sich weit rechts von der Union verortet, bekommt ebenfalls eine Botschaft, die nur eine Abkehr von CDU/CSU nach sich ziehen kann. Denn durch die gemeinsame Abstimmung mit der AfD hat die Union vor allem eins signalisiert: Stimmen für die AfD sind plötzlich nicht mehr per se macht- und folgenlos. Sie zählen auf einmal etwas im politische Spektrum.
Inhalte
Es ist ab jetzt keine Frage von Anstand oder Moral mehr, ob man als rechtsgerichteter Wähler die AfD oder die Union wählen sollte. Es ist jetzt eine Frage der machtpolitischen Logik. Die Botschaft dieser Woche an die genannte Zielgruppe lautet: Wenn du AfD-Positionen durchsetzen möchtest, muss du die AfD wählen – die Union wird diese Positionen dann schon übernehmen bzw. im Zweifel nichts dagegen haben, wenn die AfD ihnen zu Mehrheiten verhilft.
Mir geht es in dieser Analyse mit voller Absicht nicht um die unchristlichen Inhalte des 5-Punkte-Plans und es geht auch nicht um politische Ansichten dazu: es geht um die adressierte Zielgruppe, den Zeitpunkt und die daraus abgeleiteten Botschaften, die die Union sendet.
Nach allen Regeln der öffentlichen Kommunikation sind diese Botschaften kontraproduktiv wenn CDU/CSU am 23.2. mehr Wählerstimmen gewinnen wollen. Sowohl rechts als auch links entstehen verwirrende Botschaften, deren Folge nur heißen kann: Besser nicht für Friedrich Merz stimmen!
Womit ich bei der abschließende Frage bin, die sich nach dieser Woche stellt: Wieso sollten diese Leute, die schon ihren Wahlkampf nicht kommuniziert kriegen, in der Lage sein, das Land zu führen?
Mehr zum Thema hier im Blog: Widerspruch ist die beste Werbung