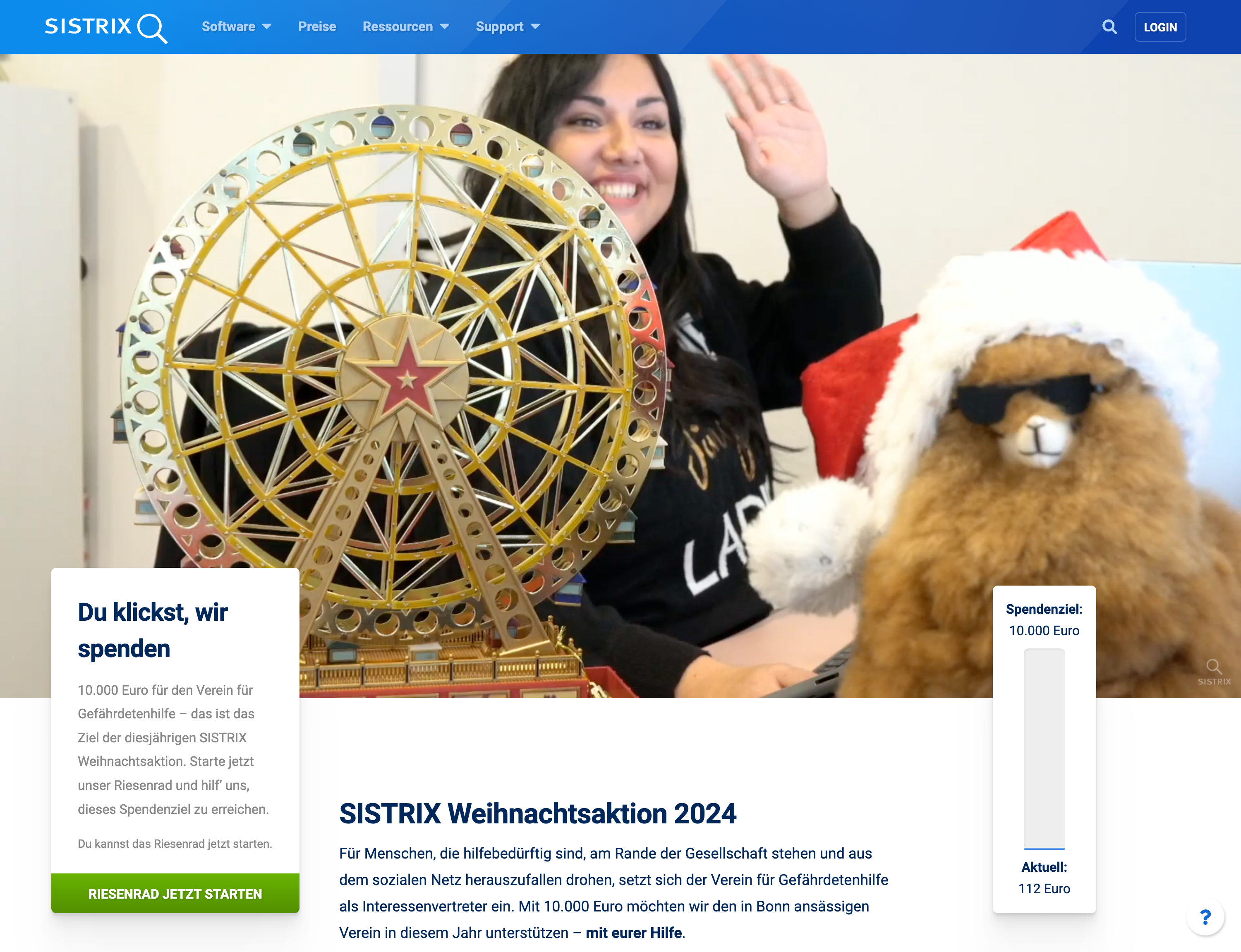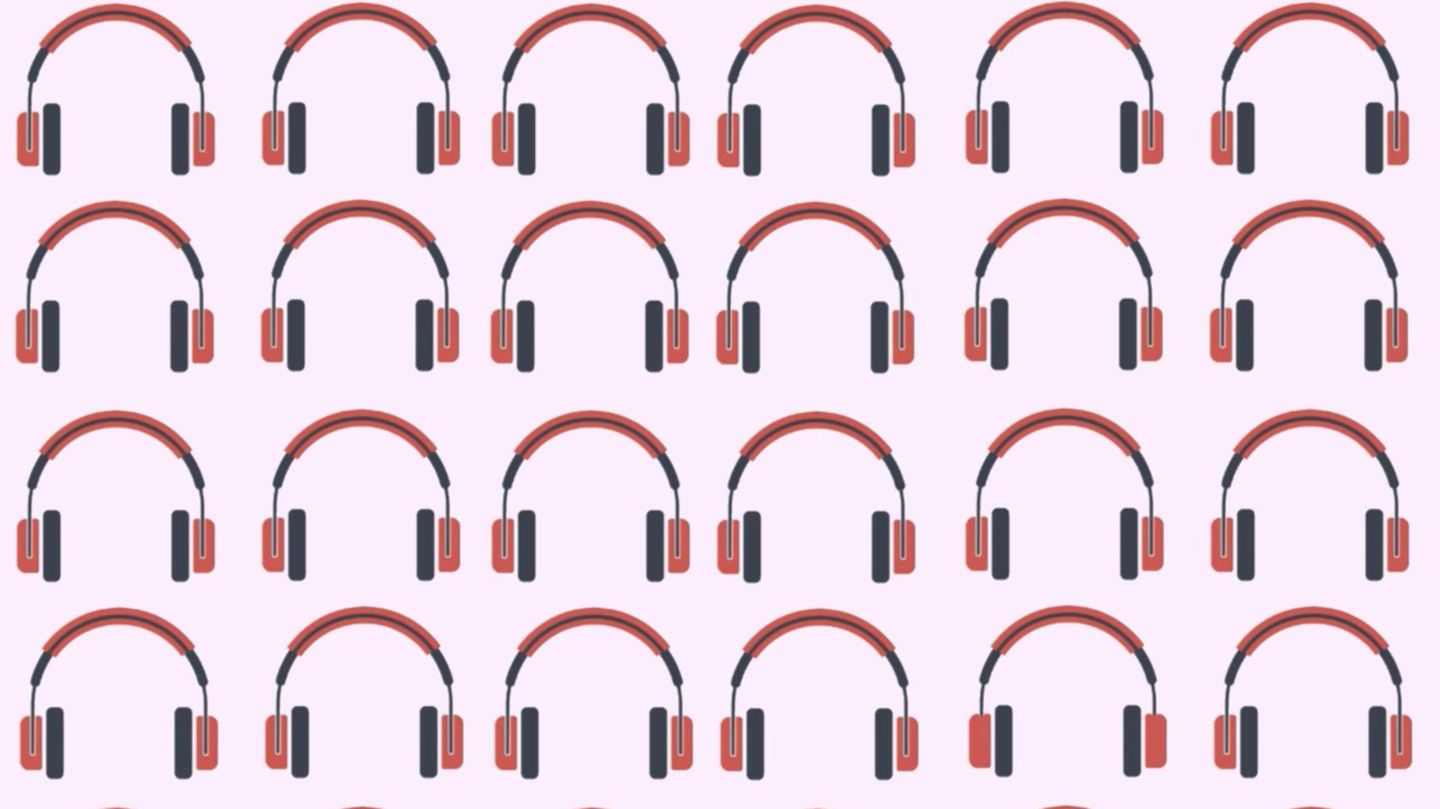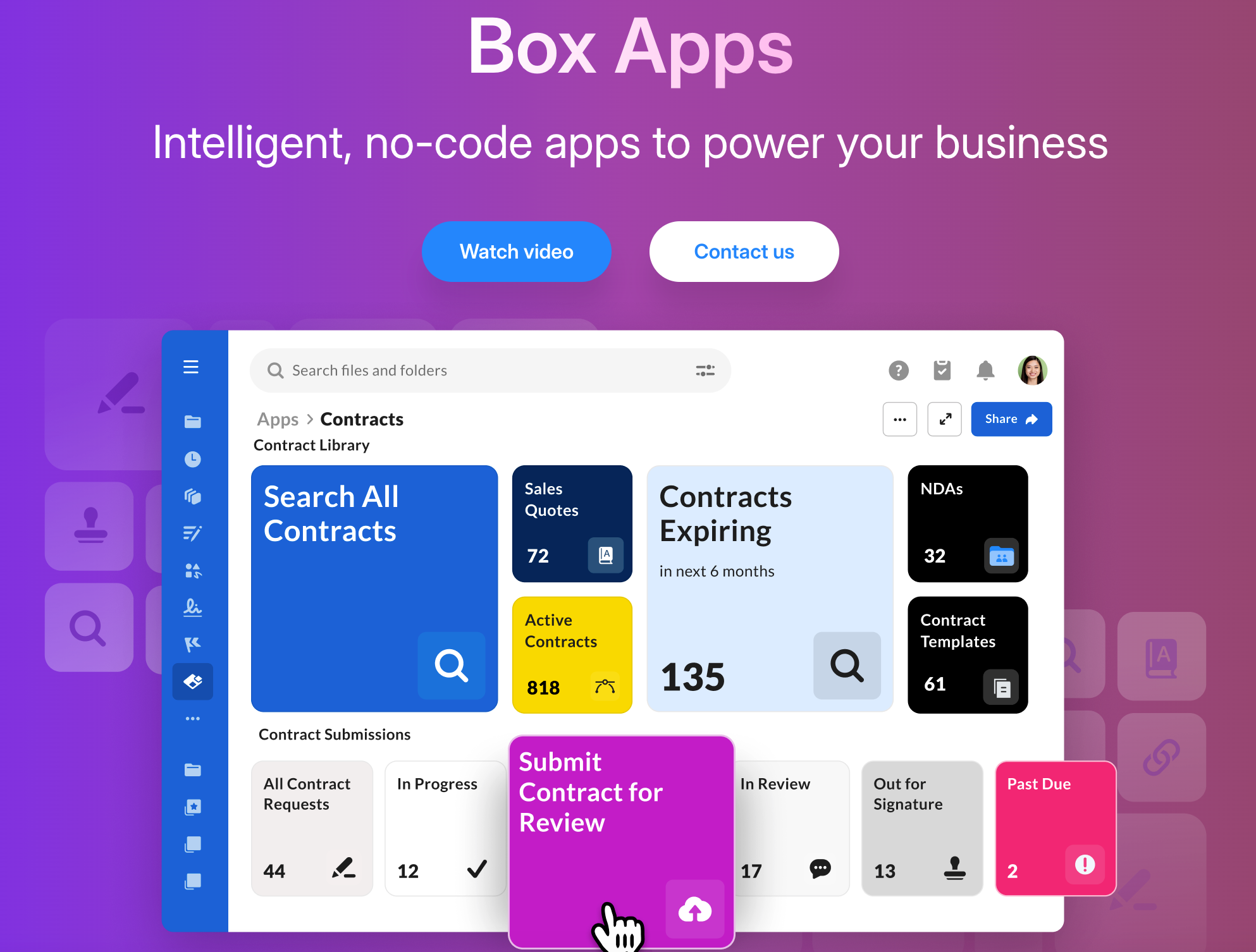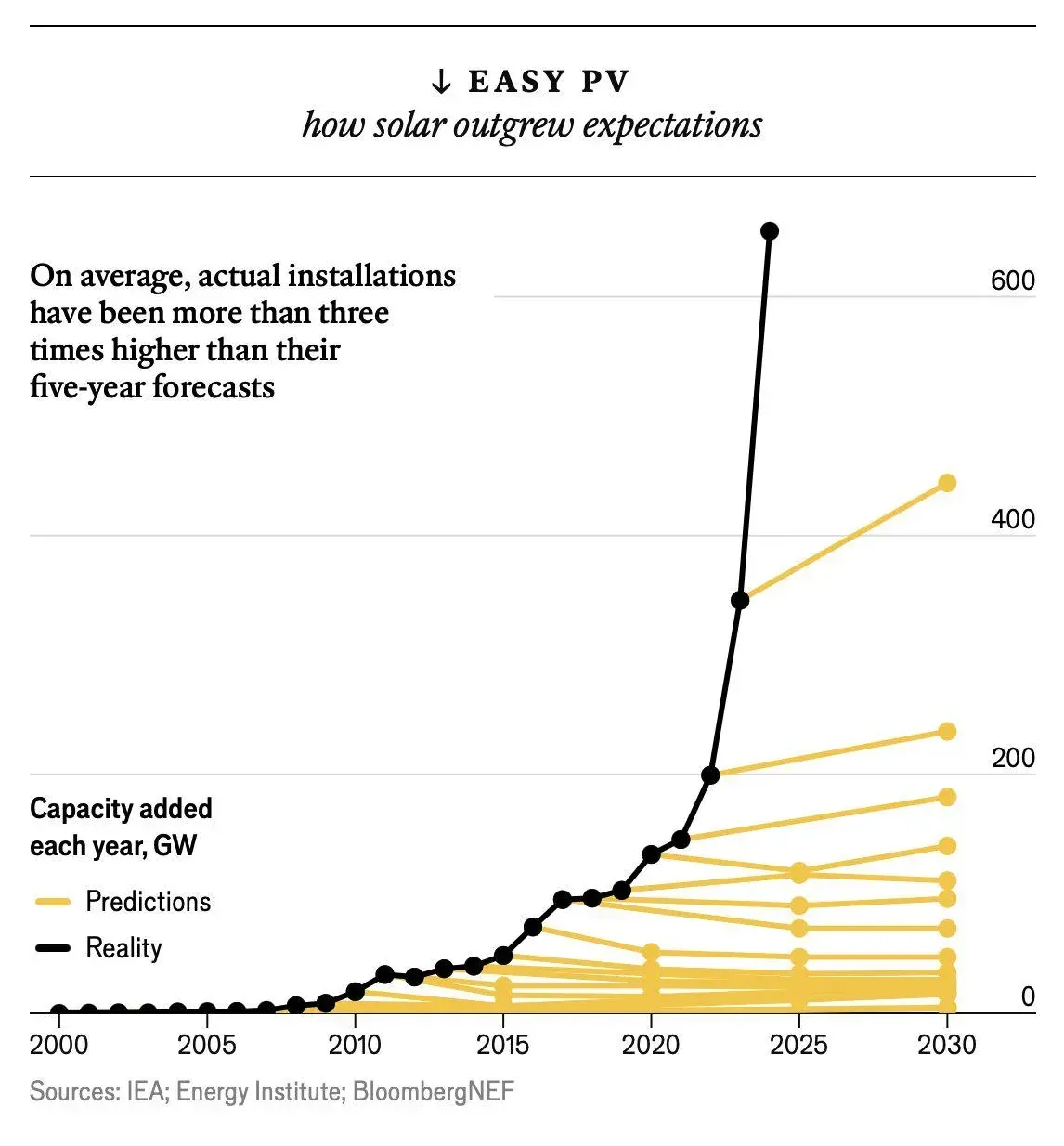Die Gesundheitsämter und die Politik [Gesundheits-Check]
Die Geschichte des Verhältnisses zwischen Gesundheitsämtern und Politik ist keine gute Geschichte. Mit dem Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens hatten die Nazis 1934 einerseits eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Gesundheitsämter geschaffen, andererseits die Gesundheitsämter zugleich auf Aufgaben der nationalsozialistischen Erb- und Rassenhygiene verpflichtet. In der Folge wurden die Gesundheitsämter zu Schaltstellen der nationalsozialistischen Medizinverbrechen, von…
![Die Gesundheitsämter und die Politik [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)
Die Geschichte des Verhältnisses zwischen Gesundheitsämtern und Politik ist keine gute Geschichte. Mit dem Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens hatten die Nazis 1934 einerseits eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Gesundheitsämter geschaffen, andererseits die Gesundheitsämter zugleich auf Aufgaben der nationalsozialistischen Erb- und Rassenhygiene verpflichtet. In der Folge wurden die Gesundheitsämter zu Schaltstellen der nationalsozialistischen Medizinverbrechen, von den Zwangssterilisationen bis zum Krankenmord. Vor diesem Hintergrund wurden die bevölkerungsmedizinischen Befugnisse der Gesundheitsämter nach dem Krieg stark beschnitten, die Sozial- bzw. Bevölkerungsmedizin war als „Staatsmedizin“ insgesamt diskreditiert.
Mit der Rückkehr der Bevölkerungsmedizin unter dem englischen Label „Public Health“ nach Deutschland in den 1980er Jahren sind auch die Gesundheitsämter wieder stärker in den Blick geraten, wenn Themen wie die Gesundheitsberichterstattung, die Prävention oder die regionale Koordination von Akteuren im Gesundheitswesen diskutiert wurden. Man nahm die Gesundheitsämter wieder als offener als potentielle Mitgestalter „kommunaler Gesundheitslandschaften“ wahr. Das 2018 von der Gesundheitsministerkonferenz verabschiedete Leitbild für den ÖGD trägt als Untertitel die Formel „Public Health vor Ort“.
In der Coronakrise sind die Gesundheitsämter in einer seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenen Weise hoheitlich in Erscheinung getreten. Sie haben zahlreiche Maßnahmen des Infektionsschutzes im öffentlichen Leben umgesetzt und überwacht, auch grundrechtseinschränkende Maßnahmen. Sie wurden damit auch mehr als vorher wieder als direkter Arm des Staates in Gesundheitsfragen wirksam und sichtbar. Dies hat die jahrelang weitgehend folgenlos geführte Diskussion um die Rolle der Gesundheitsämter bei Public Health-Aufgaben und ihre Befähigung dazu politisch virulent werden lassen. Eine unmittelbare Folge war der „Pakt für den ÖGD“, der eine personelle und technische Stärkung des ÖGD vorsieht, ausgestattet mit 4 Mrd. Euro bis Ende 2026, über die Fortsetzung des Pakts wird noch verhandelt. Des Weiteren sollte ein neues Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit eingerichtet werden, seine Zukunft ist durch den Zerfall der Ampel-Koalition derzeit offen.
Ebenfalls auf der politischen Agenda stehen Forderungen nach einer gesellschaftlichen „Aufarbeitung“ der Coronapolitik, einschließlich der Arbeit und Funktionsweise der Gesundheitsämter in der Coronakrise. Eine Autorengruppe aus der Deutschen Gesellschaft für Öffentliche Gesundheit und Bevölkerungsmedizin, einer der beiden neuen Fachgesellschaften des ÖGD, hat nun in zwei Artikeln explizit die Frage nach der politischen Steuerung der Gesundheitsämter und der ärztlichen Unabhängigkeit der Amtsärzte aufgeworfen und dabei auch an die unselige Vergangenheit der Gesundheitsämter erinnert.
Am 27.11.2024 haben Nicolai Savaskan und Peter Tinnemann in der ZEIT einen Kommentar unter der Überschrift „Haltet die Politik raus aus den Gesundheitsämtern!“ veröffentlicht, heute haben Alexandra Roth und René Gottschalk mit Frank Kunitz und Nicolai Savaskan als Mitautoren im Tagesspiegel Background unter der Überschrift „Gesundheitsämter vor politischer Polarisierung schützen“ dieses Anliegen noch einmal vorgebracht.
Die beiden Artikel eröffnen eine wichtige Diskussion, zentrale Punkte daraus sollen im Folgenden kurz kommentiert werden.
Aus dem ZEIT-Artikel:
„Die gegenwärtige politische Kultur und der Einfluss autoritär-populistischer Strömungen üben jedoch Druck auf aktuelle Debatten und auf Entscheidungen von Ärztinnen und Ärzten aus. So steht die Einflussnahme des Bundesgesundheitsministeriums auf die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts gerade im öffentlichen Diskurs.“
Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des Robert Koch-Instituts zu sichern, war ein Auftrag aus dem Koalitionsvertrag der Ampel. Bei dem geplanten neuen Bundesinstitut stellt sich die gleiche Aufgabe, darauf haben nicht nur die Public Health-Fachgesellschaften wiederholt hingewiesen. Das bisher beim RKI angesiedelte „Datengeschäft“ des Gesundheitsmonitorings und der Gesundheitsberichterstattung sollte, wenn es denn an das neue Bundesinstitut verlagert wird, nicht noch ministeriumsnäher sein, sondern ebenfalls wissenschaftlich unabhängig.
„Damit das Vertrauen der Bürgerinnen in die ärztliche Arbeit der Gesundheitsämter gesichert wird, sollten Strukturen in der öffentlichen Verwaltung überdacht werden. Ziel müssen der gesundheitliche Schutz und die Förderung aller Menschen (…) sein. Dafür ist die Sicherstellung der ärztlichen Unabhängigkeit Voraussetzung. Universitätskliniken wurden nach intensiven politischen Diskussionen und der Empfehlung des Wissenschaftsrats in selbstverwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts überführt. Diese Entwicklung hat die organisatorische Unabhängigkeit vor politischer Einflussnahme gestärkt, ohne dass dabei demokratische Prinzipien beeinträchtigt wurden.“
Hier wäre zu diskutieren, ob Gesundheitsämter wirklich mit Universitätskliniken gleichzusetzen sind. Gesundheitsämter sollen zwar in ihrer Wissenschaftlichkeit gestärkt werden, das fordert auch das Leitbild für den ÖGD, auch darin sind sich alle Fachgesellschaften einig, aber sie sind keine wissenschaftlichen Einrichtungen, sondern Vollzugsbehörden.
„Ärztliche Maßstäbe sollten darüber bestimmen, wie Bevölkerungsmedizin auszusehen hat.“
Der deutsche Terminus „Bevölkerungsmedizin“ suggeriert eine in der Sache nicht zutreffende Zuordnung von Public Health zur Medizin. Public Health ist aber eine Multidisziplin, zu der z.B. auch die Demografie, die Gesundheitssoziologie, die Gesundheitspsychologie, die Gesundheitsgeografie, die Rechtswissenschaften oder – ganz wesentlich mit Blick auf das Personal in den Gesundheitsämtern – auch die Sozialpädagogik gehören. „Ärztliche Maßstäbe“ können somit schon von der wissenschaftlichen Breite des Fachs her nicht darüber bestimmen, was Public Health ist. Des Weiteren sind die Gesundheitsämter als Teil der öffentlichen Verwaltung per se auch anderen Normen als nur „ärztlichen Maßstäben“ verpflichtet. Hier kommt m.E. ein verkürztes Verständnis der Aufgaben der Gesundheitsämter zum Ausdruck.
Aus dem Tagesspiegel Background:
Es „[] wirkt eine schleichende parteiische Einflussnahme auf Wissenschaft und Gesundheitsbehörden ein. Neben dem Problem der Aufweichung der Gewaltenteilung stellt sich die Frage, wie viel Fachlichkeit und Autonomie noch bleibt, wenn politische Interessen zunehmend wissenschaftliche Entscheidungen lenken. Ein Exempel sind die vielen Interventionen des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) auf die Risikoeinschätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) – und das gerade vor dem Hintergrund eines Gesundheitsministers, der für eine sogenannte ‚evidenz-geleitete‘ Gesundheitspolitik eintrat.
Wie gut sind also Gesundheitsämter gegen politische Polarisierung und Einflussnahme gewappnet?“
Dieser Punkt wiederholt die grundsätzliche Positionierung aus der ZEIT und auch hier wäre anzumerken, dass die Gesundheitsämter nicht umstandslos als wissenschaftliche Einrichtungen gelten können. Beim Robert Koch-Institut handelt es sich immerhin um eine Ressortforschungseinrichtung und hier stellt sich in der Tat die Frage der wissenschaftlichen Unabhängigkeit – in der für die Ressortforschung spezifischen Eigenheit.
„Bereits kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden die Gesundheitsämter gleichgeschaltet und einer zentralen Struktur überführt, die bis heute noch besteht. Nicht wenige Amtsärzte verstanden sich als Hüter der Volksgesundheit und leisteten einen unentschuldbaren Beitrag zur Umsetzung der NS-Ideologie – eine geschichtliche Last, die bis heute wenig in Gesundheitsämtern reflektiert und erinnert wird.“
Die „zentrale Struktur“ des Vereinheitlichungsgesetzes besteht nicht mehr. Der ÖGD ist Gegenstand der Gesundheitsdienstgesetze der Länder, die erhebliche Unterschiede aufweisen. In den meisten Ländern sind die Gesundheitsämter zudem kommunalisiert, nur wenige, z.B. Bayern, haben noch staatliche Gesundheitsämter und auch diese unterstehen nicht dem Bundesgesundheitsministerium. Inwiefern die historische Last in den Gesundheitsämtern zu wenig reflektiert wird, ist eine empirische Frage, das wäre eine organisationssoziologische Studie wert.
„In mehreren Gesundheitsämtern, darunter Hannover, Düsseldorf und Dresden, wurden ärztliche Leitungen während der Pandemie abgesetzt oder ausgetauscht. In einzelnen Ländern wie Sachsen, Hessen oder Bremen wurden die Gesundheitsdienstgesetze soweit verändert, dass für die Leitung beziehungsweise Stellvertretungen keine medizinische Qualifikation mehr erforderlich ist. Das bedeutet, dass einige Gesundheitsämter, die nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz als medizinische Einrichtungen vergleichbar zu Krankenhäusern gelten, nicht mehr von Ärzt*innen sondern von Fachfremden Jurist*innen oder Verwaltungswirt*innen geleitet werden.“
Das sog. „Amtsarztprivileg“, dass Gesundheitsämter nur von Ärzt:innen geleitet werden sollen, ist seit einiger Zeit brüchig. Es tradiert aus der Vergangenheit der Gesundheitsämter im Landgerichtsarzt- und Kreisarztwesen. Ob es in großen Gesundheitsämtern noch zeitgemäß ist, oder ob hier eine ärztliche Leitung nur in ärztlichen Aufgabenbereichen nötig ist, wäre zu diskutieren. Hier müssten fachliche Argumente und berufsständische Interessen auseinandergehalten werden.
„Solche Hilfskonstrukte stehen tatsächlich in Konflikt mit der ärztlichen Berufsordnung, die eine Weisungsunabhängigkeit von Ärzt*innen vorsieht.“
Die ärztlichen Berufsordnungen sehen diese Weisungsunabhängigkeit bei ärztlichen Entscheidungen vor, nicht bei allen Entscheidungen im Gesundheitsamt, auch nicht bei allen Public Health-Entscheidungen.
„Parteiische Eingriffe auf ärztliche Entscheidungen sind nicht demokratisch legitimiert und befeuern die Polarisierung sogar noch. Vor dem Hintergrund des Wahlausgangs in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sehen wir spätestens jetzt einen dringenden Handlungsbedarf für die öffentliche Gesundheit.
Ziel muss sein, die Unabhängigkeit der Ärzt*innen in den Gesundheitsämtern nicht nur weisungsrechtlich, sondern auch organisatorisch sicherzustellen.“
Geht es um die Unabhängigkeit der Ärzt:innen oder der Gesundheitsämter? Und was sind „parteiische Eingriffe“? Wenn es um rechtswidrige Eingriffe geht, sind die verbeamteten Ärzte gehalten, ihre Remonstrationspflicht wahrzunehmen. Inwiefern andere organisatorische Lösungen hier wirklich Vorteile bringen, ist ebenfalls ein offener Diskussionspunkt.
„Naheliegend ist, Gesundheitsämter zum Beispiel in Körperschaften des öffentlichen Rechts zu überführen. Damit bleiben Gesundheitsämter weiterhin vollziehende Staatsverwaltung, allerdings in einem anderem Distanzverhältnis.
Besteht dadurch ein Verlust demokratischer Kontrolle und Durchgriffsrechte? Nein, und das in zweifacher Hinsicht. Denn erstens werden Körperschaften durch einen Verwaltungsrat und Landesministerien kontrolliert. Und zweitens sind Körperschaften des öffentlichen Rechts Teil der Staatsverwaltung, nur mit dem Unterschied, dass sie sich selbst verwalten.“
In diesem Punkt wird die Argumentationslinie m.E. brüchig. Man will mehr organisatorische Unabhängigkeit, weist aber zugleich auf die Notwendigkeit „demokratischer Kontrolle und Durchgriffsrechte“ hin. Wer nimmt diese wahr? Im darauffolgenden Satz werden die Länderministerien angesprochen, aber war nicht gerade mehr Distanz zur Politik das Ziel? Ist dieses Ziel an sich überhaupt unstrittig, oder braucht der Staat für Public Health-Aufgaben gerade Durchgriffsrechte auf die Gesundheitsämter? Die Autoren sprechen das Stichwort selbst an. Daran schließen sehr grundsätzliche Fragen an, was Staatsaufgaben sind und was nicht. Und last, but not least: Wie kann eine „demokratische Kontrolle“ aussehen, wenn die demokratisch legitimierten Institutionen – Parlament und Regierung, Stadträte und Bürgermeister, Kreistage und Landräte – in demokratische Schieflage geraten?
An der Stelle reflektieren die Autor:innen das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Gesundheitsverwaltung nicht gründlich genug. Sie machen auf ein Problem aufmerksam, aber über die Lösung wäre eingehender nachzudenken.
„Eine Lehre aus der Pandemie wäre es tatsächlich, Gesundheitsämter ethisch krisensicher zu machen.“
Das ist auf jeden Fall richtig und Teil einer noch zu leistenden „Aufarbeitung“. Für die Gesundheitsämter ist dabei u.a. so etwas wie ein Ethikkodex überfällig, jenseits der spezifisch ärztlichen Berufsethik. Ein solcher Ethikkodex wäre eine Aufgabe für die beiden ÖGD-Fachgesellschaften, in Zusammenarbeit mit universitären Ethiker:innen.
Die beiden Artikel regen somit eine wichtige Diskussion an und zeigen, wie praxisrelevant und grundsätzlich zugleich Fragen des Verhältnisses von Wissenschaft, Ethik, Politik und Verwaltung beim ÖGD sind. Diese Diskussion kann nicht in der Engführung am ärztlichen Berufsrecht erfolgen, und auch nicht nur mit ärztlicher Expertise, hier ist die ganze Breite von Public Health gefragt und speziell juristische Expertise ist dabei ersichtlich unverzichtbar.